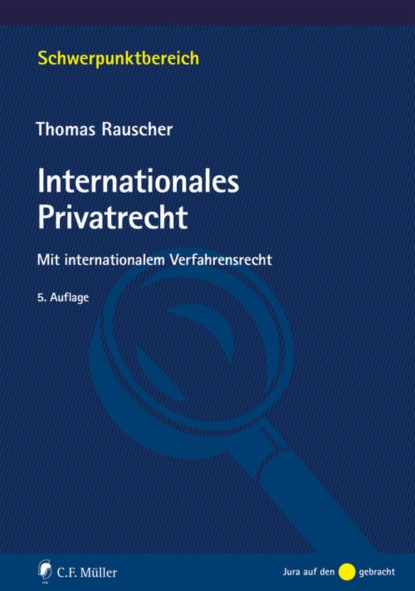
Полная версия:
Internationales Privatrecht
395
a) Fehlt es an einem einheitlichen IPR, so stößt die deutsche Gesamtverweisung in der fremden Gesamtrechtsordnung ins Leere. Daher muss schon für die Ermittlung des fremden IPR eine Teilrechtsordnung ausgewählt werden. Meist fehlt in diesem Fall auch ein einheitliches internes Kollisionsrecht. Diese Konstellation tritt nahezu ausschließlich bei territorialer Rechtsspaltung auf. Es entspricht insbesondere dem Selbstverständnis von Bundesstaaten mit stark föderaler Struktur, in den Bereichen, in denen jeder Staat im materiellen Recht Gesetzgebungshoheit besitzt, auch die Rechtsanwendung im Verhältnis zueinander nicht zentral, sondern wie zwischen fremden Staaten abzugrenzen.
396
b) Art. 4 Abs. 3 S. 2 führt dann in die Teilrechtsordnung, mit welcher der Sachverhalt am engsten verbunden ist. Die Kriterien der engsten Verbindung sind nicht zweifelsfrei: Man könnte vertreten, es müssten (nach dem Rechtsgedanken des Art. 4 Abs. 3 S. 1) Anknüpfungskriterien des verwiesenen Rechts herangezogen werden, insbesondere also kollisionsrechtliche Prinzipien, welche die Teilrechtsordnungen dieses Staates übereinstimmend anwenden. Hiergegen spricht, dass die fremde Rechtsordnung sich offensichtlich kollisionsrechtlich nicht als eine Einheit versteht, so dass das Angebot des Art. 4 Abs. 3 S. 1, ihr die Unteranknüpfung zu überlassen, abgelehnt wird. Dann aber ist es Sache des deutschen IPR, die Gesamtverweisung mit seinen IPR-Kriterien zum Ziel zu bringen, also gleichsam den Mehrrechtsstaat als eine Mehrzahl von Staaten zu behandeln.
397
Dabei dürfen das Anknüpfungssubjekt und das Anknüpfungskriterium nicht ausgetauscht werden: Es ist also nicht irgendeine engste Verbindung des Sachverhalts zu suchen, sondern die engste Beziehung des Anknüpfungssubjekts (aus deutscher Sicht) zu einer Teilrechtsordnung. Das Anknüpfungskriterium muss allenfalls verfeinert werden, wenn es innerhalb des verwiesenen Staates nicht zu einer Differenzierung führt.
Verstarb ein US-Staatsangehöriger 2014 und hat ein deutsches Nachlassgericht einen Erbschein zu erteilen, so verweist Art. 25 Abs. 1 aF in das Recht der USA. Dort gibt es weder ein einheitliches materielles Erbrecht noch einheitliches Erbkollisionsrecht; allerdings gibt es sehr ähnliche – auf dem Common Law aufbauende – kollisionsrechtliche Prinzipien in den einzelnen Bundesstaaten. Die engste Verbindung ist nun aber nicht nach diesen fremden Prinzipien (für Mobilien dem domicile des Erblassers) zu bestimmen. Es muss die Staatsangehörigkeitsanknüpfung verfeinert werden, weil die Staatsangehörigkeit zu den USA innerhalb der USA kein unterscheidendes Kriterium ist. Da es aber neben der Federal citizenship zu den USA auch eine State citizenship gibt, kann auf diese abgestellt werden[78] – nicht als fremde Kollisionsregel, sondern als fremde Staatsangehörigkeitsregel in weiterem Sinn. Hat ein US-citizen keine State citizenship, so hilft der Rechtsgedanke des Art. 5 Abs. 2: Im deutschen IPR ist der gewöhnliche Aufenthalt die nächste Hilfsanknüpfung, wenn die Staatsangehörigkeit als Anknüpfungskriterium versagt. Unter der EU-ErbVO (Erbfall seit 17.8.2015) ist bei Maßgeblichkeit des Rechtes der USA (Heimatrechtswahl nach Art. 22 Abs. 1 EU-ErbVO) ebenfalls die engste Verbindung zu einem Einzelstaat zu bestimmen (Art. 36 Abs. 2 lit. b EU-ErbVO).
398
c) Nimmt das IPR der Teilrechtsordnung, zu der die engste Verbindung besteht, die Verweisung an, so bezieht sich diese Annahme unmittelbar auf diese Teilrechtsordnung und nicht mehr auf den Gesamtstaat; ein internes Kollisionsproblem zum gespaltenen materiellen Recht tritt nicht auf. Verweist sie weiter oder zurück, so ist diese Verweisung ebenfalls auf internationaler Ebene zu behandeln.
3. Gespaltenes IPR und einheitliches internes Kollisionsrecht
399
In seltenen Fällen haben Mehrrechtsstaaten kein einheitliches IPR, das Recht des Gesamtstaates enthält jedoch interne Kollisionsregeln zur Verteilung der Sachverhalte an die einzelnen (internationalprivatrechtlichen und materiellen) Teilrechtsordnungen. Für die Gesamtverweisung des deutschen IPR bedarf es einer Unteranknüpfung. Soweit es ein einheitliches internes Kollisionsrecht gibt, bestimmt dieses (Art. 4 Abs. 3 S. 1), welche Teilrechtsordnung (einschließlich ihres IPR) anzuwenden ist.
In Mexico sind das IPR und das materielle Privatrecht interlokal gespalten; jeder Bundesstaat hat einen eigenen código civil mit eigenem IPR. Dieses IPR – und einzelne bundesstaatliche interlokale Normen – finden jedoch auf interlokale Konflikte nur Anwendung, soweit nicht die mexikanische Bundesverfassung, zB zu Rechten an beweglichen und unbeweglichen Sachen, eine territoriale Kollisionsnorm enthält. Soweit ein solches einheitliches interlokales Recht fehlt, sind aus deutscher Sicht (wie Rn 397) die Anknüpfungskriterien des deutschen IPR fortzusetzen.
4. Einheitliches IPR ohne einheitliches internes Kollisionsrecht?
400
a) Besitzt ein Staat ein einheitliches IPR, aber gespaltenes materielles Recht, so sind – denknotwendig – interne Kollisionsregeln vorhanden: Erklärt das IPR dieses Staates nämlich eigenes Recht für anwendbar, so müssen Gerichte dieses Staates entscheiden, welche Teilrechtsordnung anzuwenden ist. Diese internen (interlokalen oder interpersonalen) Regeln können unkodifiziert oder in Zuständigkeitsregeln versteckt sein; ist zB innerstaatlich ein Gericht nur in festgelegten Konstellationen zuständig und wendet dann die lex fori an, so beinhaltet das aus deutscher Sicht eine interne Kollisionsnorm.
401
b) Probleme in der Ermittlung dieses internen Kollisionsrechts treten häufig bei interpersonal gespaltenen Rechtsordnungen auf. Solche Staaten haben ganz überwiegend ein einheitliches IPR und häufig auch ausdrückliche (staatliche) Grundsätze zur Lösung interpersonaler Kollisionen. Jedenfalls in den Ländern, in denen staatliche Gerichte das religiöse Recht in Familien- und Erbsachen anwenden (zB Ägypten, Tunesien, Indien, Pakistan), stehen diese Gerichte zwangsläufig selbst vor dem interpersonalen Kollisionsproblem: Jeder Staatsangehörige kann die staatlichen Gerichte in Anspruch nehmen, das Gericht muss also das richtige religiöse Recht auswählen.
402
c) Selbst in den Staaten, die diese Rechtssachen religiösen Gerichten überlassen (zB Syrien), gibt es zumindest Zuständigkeitsregeln, die als versteckte Kollisionsnormen verstanden werden können, sofern sie eine eindeutige Zuständigkeit aussprechen.
403
d) Teilweise kann sich das intern anwendbare Recht auch aus dem Typus einer familienrechtlichen Beziehung ergeben, welche die Beteiligten gewählt haben. Einige ehemalige englische und französische Kolonien in Afrika sehen wahlweise eine Zivilehe und Stammesehen vor: Hier beurteilt sich dann das weitere Schicksal der Rechtsbeziehung nach dem ursprünglich gewählten Typus.
Literatur:
Staudinger/Hausmann (2013) Art. 4 EGBGB Rn 375-429; MüKoBGB/v. Hein (6. Aufl., 2015) Art. 4 EGBGB Rn 166-251.
II. Sachnormverweisungen in Mehrrechtsstaaten
404
1. Ist die deutsche Verweisung Sachnormverweisung, so spielt es keine Rolle, ob der ausländische Staat ein einheitliches IPR hat, weil auf dieses ohnehin nicht verwiesen ist. Zu unterscheiden ist nur danach, ob ein einheitliches internes Kollisionsrecht besteht.
405
2. Hat der ausländische Mehrrechtsstaat ein einheitliches internes (interlokales oder interpersonales) Kollisionsrecht, so bestimmt dieses die maßgebliche materielle Teilrechtsordnung (Art. 4 Abs. 3 S. 1).
Verweist Art. 19 Abs. 1 S. 2 für die Feststellung der Vaterschaft alternativ auf das Recht von Bosnien und Herzegowina als Heimatrecht des als Vater in Betracht kommenden Mannes, so ist dies (auch) eine Sachnormverweisung. Die maßgebliche Teilrechtsordnung ist nach dem BuH-ILRG auszuwählen: Hat der Mann zB einen Wohnsitz in der Republika Srpska, so ist nach Art. 28 Abs. 1 BuH-ILRG diese Teilrechtsordnung maßgeblich (vgl Rn 394).
406
3. Hat der ausländische Mehrrechtsstaat ein gespaltenes internes Kollisionsrecht, so ist die engste Verbindung des Sachverhalts maßgeblich (Art. 4 Abs. 3 S. 2), die nach deutschen Anknüpfungskriterien bestimmt wird (vgl Rn 396).
Ist im Beispielsfall (soeben Rn 405) der Mann US-Amerikaner, so besteht die engste Verbindung zu dem Bundesstaat, dessen State citizenship er besitzt, hilfsweise zum Bundesstaat seines gewöhnlichen bzw letzten gewöhnlichen Aufenthaltes.
III. Ausnahme: Bezeichnung der maßgeblichen Teilrechtsordnung durch deutsches IPR
407
1. Eine Ausnahme in der Bestimmung der maßgeblichen Teilrechtsordnung greift ein, wenn das deutsche IPR die maßgebliche Teilrechtsordnung bezeichnet (Art. 4 Abs. 3 S. 1). Die Reichweite ist zweifelhaft, da das deutsche IPR – technisch betrachtet – immer eine fremde Rechtsordnung als ganze und nie eine Teilrechtsordnung bezeichnet. Gemeint sind Fälle, in denen die deutsche Kollisionsnorm ein Anknüpfungskriterium verwendet, das sich zugleich eignet, eine unter mehreren Teilrechtsordnungen auszuwählen.
Verweist Art. 11 Abs. 1 für die Form auf den Ort eines Vertragsschlusses und liegt dieser Ort in den USA, so kann mittels des Kriteriums „Ort“ eine der räumlich gespaltenen Teilrechtsordnungen ausgewählt werden – zB Vertragsschluss in Honolulu, Recht von Hawaii. Dagegen kann mit dem Kriterium „Ort“ in einer interpersonal gespaltenen Rechtsordnung keine Auswahl getroffen werden; es kommt also immer darauf an, ob die deutsche Anknüpfung mit der fremden Rechtsspaltung – zufällig – harmoniert.
408
2. Unstreitig ist diese Methode der Unteranknüpfung anzuwenden, wenn das Kollisionsrecht gespalten ist oder wenn eine Sachnormverweisung in gespaltenes materielles Recht führt. Umstritten ist dagegen, ob diese Ausnahme auch eingreift, wenn in dem Mehrrechtsstaat ein einheitliches IPR gilt. Eine Ansicht bejaht das und bestimmt nach der Annahme der Verweisung durch das fremde IPR die maßgebliche Teilrechtsordnung mit den Kriterien des deutschen IPR.[79]
Diese Verfahrensweise entspricht scheinbar dem Wortlaut, ist aber systematisch unrichtig: Wenn der fremde Staat mit einheitlichem IPR die Verweisung annimmt, ist der Fall dem deutschen IPR entzogen; es können dann nur noch Kriterien des ausländischen Rechts maßgeblich sein. Das deutsche IPR kann nur solange die Teilrechtsordnung „bezeichnen“, wie die deutsche Verweisung noch ihr erstes „Ziel“ (Gesamtverweisung: IPR, Sachnormverweisung: materielles Recht) sucht. Hat das deutsche Recht den Fall an das fremde Recht abgegeben, so kann es sich in die Unteranknüpfung nicht mehr einschalten.[80]
Hat ein Kind, für das die Abstammung zum Vater zu bestimmen ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bosnien und Herzegowina, so verweist Art. 19 Abs. 1 S. 1 auf bosnisch-herzegowinisches Recht. Beide Ansichten prüfen eine Rückverweisung am BuH-IPRG. Ist der Mann Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, so nimmt Art. 41 BuH-IPRG die Verweisung an. Die Gegenansicht würde jetzt die maßgebliche Teilrechtsordnung wieder nach Art. 19 Abs. 1 S. 1 bestimmen, sofern das Kind in einer Teilrepublik seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, weil dies als Bezeichnung der maßgebenden Rechtsordnung verstanden wird. Fehlt ein gewöhnlicher Aufenthalt in Bosnien und Herzegowina, richtet sich die hM nach dem BuH-ILRG. Die hier vertretene Ansicht wendet hingegen nach Annahme der Verweisung nur noch das interne Recht des ausländischen Staates an, also das BuH-ILRG, das stufenweise auf den gemeinsamen Wohnsitz, die gemeinsame Republikzugehörigkeit oder Wohnsitz bzw Republikzugehörigkeit des Klägers abstellt (Art. 22 BuH-ILRG).
IV. Mehrrechtsstaaten im EuIPR
409
1. Ist die Verweisung in Mehrrechtsstaaten durch Kollisionsnormen im EU-Recht eine Sachnormverweisung (Rn 391 ff), so interessiert gespaltenes IPR nicht. In Anwendung von Art. 34 EU-ErbVO muss dagegen bei Mehrrechtsstaaten, wie im deutschen IPR, ein maßgebliches IPR eines Teilgebiets des verwiesenen Staates ermittelt werden. Da es dem EuIPR an einer einheitlichen Kodifikation mit einem allgemeinen Teil des IPR mangelt, enthält jede einzelne Verordnung Bestimmungen zur Unteranknüpfung (Art. 22 Rom I-VO, Art. 25 Rom II-VO, Art. 14 ff Rom III-VO, Art. 15 EG-UntVO iVm Art. 15 ff HUntStProt 2007; Art. 36, 37 EU-ErbVO; Art. 33, 34 EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO).
410
2. Bei interlokaler Spaltung wird jede Teil-Jurisdiktion wie ein eigenständiger Staat behandelt (Art. 22 Abs. 1 Rom I-VO, Art. 25 Abs. 1 Rom II-VO, Art. 14 Rom III-VO). Räumliche Bezugnahmen führen ohne weiteres in eine Teilrechtsordnung. Interlokales Recht der verwiesenen Rechtsordnung spielt keine Rolle. Anders verfahren Art. 15 EG-UntVO iVm Art. 16 Abs. 2 HUntStProt 2007, Art. 36 Abs. 1 EU-ErbVO und Art. 33 Abs. 1 EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO: Dort bestimmt primär das interlokale Recht des verwiesenen Staates; nur bei Ermangelung eines einheitlichen interlokalen Rechts weist räumliche Bezugnahme der Kollisionsnorm unmittelbar in eine Teilrechtsordnung.
Bezugnahmen einer Kollisionsnorm auf die Staatsangehörigkeit sind in Art. 14 lit. c Rom III-VO, Art. 15 EG-UntVO iVm Art. 16 Abs. 1 lit. d, e HUntStProt 2007, Art. 36 Abs. 1, Abs. 2 lit. b EU-ErbVO und Art. 33 Abs. 1 lit. b EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO behandelt: Sie werden über das interlokale Recht des verwiesenen Staates auf die Teilrechtsordnungen verteilt; fehlt eine interlokale Regelung, so ist die engste Verbindung maßgeblich. Soweit eine Rechtswahlbefugnis besteht (Rom III-VO und EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO), ist auch die unmittelbare Wahl einer Teilrechtsordnung zuzulassen.
Haben deutsche Ehegatten, die in London leben, als Scheidungsstatut „das Recht des Vereinigten Königreichs“ vereinbart (wählbar nach Art. 5 Abs. 1 lit. a Rom III-VO) und leben sie bei Antragstellung in Deutschland, so wird mangels interlokaler Regelungen im Recht des UK auf die engste Verbindung abgestellt, die hier zum englischen Recht besteht. Besser beraten hätten sie sogleich englisches Recht wählen können.
411
3. Mit interpersonaler Spaltung befassen sich Art. 15 Rom III-VO, Art. 15 EG-UntVO iVm Art. 17 HUntStProt 2007, Art. 37 EU-ErbVO und Art. 34 EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO: Nach allen Normen bestimmt vorrangig das interne Kollisionsrecht der verwiesenen Rechtsordnung; bei Fehlen entscheidet jeweils die engste Verbindung. In Art. 17 HUntStProt 2007 ist dies nicht ausdrücklich bestimmt, sollte aber im Wege einer Gesamtanalogie ebenso gehandhabt werden. Bei interpersonaler Spaltung kann die jeweils auf Rechtsordnungen bestimmter Staaten eingeschränkte Rechtswahlbefugnis nicht auf eine interpersonale Rechtsordnung bezogen werden.
Haben ägyptische Ehegatten, der Ehemann sunnitischer Muslim, die Ehefrau koptische Christin, ägyptisches Recht als Scheidungsstatut gewählt (zulässig nach Art. 5 Abs. 1 lit. c Rom III-VO; beachte: die Rom III-VO ist loi uniforme gemäß Art. 4 Rom III-VO, ein Bezug zu einem anderen teilnehmenden Mitgliedstaat also nicht erforderlich), so ist die Ehe gemäß dem internen ägyptischen Kollisionsrecht nach sunnitisch-islamischem Recht zu scheiden. Den Ehegatten ist es nach Art. 15 Rom III-VO nicht möglich, eine andere interne Rechtsordnung Ägyptens zu wählen.
Ein wenig sonderbar mutet folgender Fall an: Leben zwei deutsche Ehegatten in Ägypten, wählen ägyptisches Recht als Scheidungsstatut (wirksam nach Art. 5 Abs. 1 lit. a Rom III-VO) und konvertiert der Ehemann zum sunnitischen Islam, so gilt für die Bestimmung des Scheidungsstatuts vor einem deutschen Gericht wiederum Art. 15 Rom III-VO. Zwar beurteilt das interne ägyptische Kollisionsrecht religiöse Mischehen nach der Religion des Mannes, was vor ägyptischen Gerichten aber nur relevant wird, wenn das ägyptische IPR das ägyptische Recht beruft. Die beiden Deutschen würden somit ohnehin in Ägypten nach deutschem Heimatrecht des Ehemannes (Art. 13 Abs. 1 ägyptZGB[81]) geschieden werden. Da Art. 5 Rom III-VO jedoch keine Gesamtverweisung ausspricht, bleibt diese Sicht ägyptischer Gerichte irrelevant; das deutsche Familiengericht muss eine interpersonale Anknüpfung für die Ehescheidung verschiedenreligiöser Deutscher im ägyptischen Recht suchen. Ob die dann naheliegende Übernahme der Anknüpfung an die Religion des Mannes ordre public-widrig ist, erscheint angesichts der einvernehmlichen Unterstellung unter ägyptisches Scheidungsrecht fraglich.
412
4. Da EuIPR nicht auf die inneren Verhältnisse eines Mitgliedstaates regelnd zugreifen kann, ist kein Mitgliedstaat mit mehreren Rechtsordnungen verpflichtet, seine internen Rechtskollisionen nach den Bestimmungen der jeweiligen EG-/EU-Verordnung zu beurteilen (Art. 22 Abs. 2 Rom I-VO, Art. 25 Abs. 2 Rom II-VO, Art. 16 Rom III-VO, Art. 38 EU-ErbVO, Art. 35 EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO). Im Erb- und Ehegüterrecht betrifft dies mangels Teilnahme des UK insbesondere Spanien und seine Foralrechte (leyes forales).[82]
Teil II Allgemeine Lehren des IPR › § 3 Verweisung › D. Intertemporale Kollisionen
I. Methoden der Anknüpfung
413
1. Intertemporale Kollisionen (Rn 16 ff) können an jeder Stelle der Verweisung auftreten. Die Ablösung von altem durch neues Recht kann im deutschen und im ausländischen IPR sowie in der schließlich anwendbaren materiellen Rechtsordnung zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Beginn des Sachverhalts, betrachtet als natürlicher Lebensvorgang, erfolgt sein.
414
2. Für die intertemporale Frage (ist altes oder neues Recht anzuwenden?) kommt Art. 4 Abs. 3 nicht unmittelbar zur Anwendung, da mit „Teilrechtsordnung“ nicht aufeinanderfolgende, in einem einheitlichen Rechtsgebiet geltende Regelungen gemeint sind. Das Grundprinzip zur Lösung ähnelt jedoch der Idee des Art. 4 Abs. 3: Es entscheidet die Rechtsordnung, in der die Reform des Rechts stattgefunden hat, welche Sachverhalte von der Reform erfasst sind.
415
3. Theoretisch führt dieses Prinzip immer zum Ziel, denn jede Rechtsordnung muss wissen, ob sie auf einen bestimmten Sachverhalt noch das alte oder schon das neue Recht anwendet. Die Schwierigkeit intertemporaler Fälle liegt im Tatsächlichen: Viele Gesetzgeber sehen keine ausdrücklichen intertemporalen Regelungen vor oder begnügen sich mit der Kodifikation des Grundsatzes, dass Gesetze nicht zurückwirken. Nicht-Rückwirkung ist aber die Kehrseite von Abgeschlossenheit: Ist ein Fall abgeschlossen, so wäre die Anwendung neuen Rechts Rückwirkung. Das intertemporale Problem wird also durch das Rückwirkungsverbot nur umformuliert.
416
Im deutschen Recht herrscht der Grundsatz, dass ein Erbfall abgeschlossen ist mit seinem Eintritt durch den Tod des Erblassers (vgl Art. 220 Abs. 1, Art. 235 § 1). Im russischen Recht galt anlässlich einiger Reformen im 20. Jahrhundert ein Erbfall dagegen erst als abgeschlossen, wenn die gerichtliche Nachlassabwicklung stattgefunden hat.
417
Die Vielfalt möglicher intertemporaler Gestaltungen lässt sich an den Übergangsbestimmungen zu zwei umfangreichen deutschen Rechtsreformen, dem Gesetz zur Neuregelung des IPR von 1986 und der Überleitung des Bundesrechts auf das Beitrittsgebiet im Einigungsvertrag von 1990, betrachten (Rn 420 ff, 428 ff).
418
Ebenfalls intertemporale Fragen wirft das Inkrafttreten von Normen des EuIPR auf, da diese nationale Kollisionsregeln ablösen. Bisher enthalten die jeweiligen Verordnungen hierzu Bestimmungen, wobei zu unterscheiden ist zwischen dem Inkrafttreten, der Geltung und der intertemporalen Anwendbarkeit. Das Inkrafttreten bezieht sich auf die Wirksamkeit als Norm; soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist (zB in Art. 29 S. 1 Rom I-VO), tritt eine Verordnung am Tag nach der Veröffentlichung im ABl. EU in Kraft. Die Geltung ist regelmäßig in einer Schlussbestimmung hinausgeschoben, insbesondere um den Mitgliedstaaten Zeit für Durchführungsbestimmungen und/oder die Schaffung notwendiger behördlicher Strukturen zu geben (Art. 29 S. 2 Rom I-VO, Art. 32 Rom II-VO, Art. 21 S. 2 Rom III-VO; Art. 76 EG-UntVO; Art. 84 Abs. 2 EU-ErbVO; Art. 70 Abs. 2 UAbs. 2 EU-EheGüterVO; Art. 70 Abs. 2 UAbs. 2 EU-ELPGüterVO). Die intertemporale Frage regeln hingegen Bestimmungen, die als „Übergangsbestimmungen“ oder „Zeitliche Anwendbarkeit“ überschrieben sind. Die Rom I-VO gilt nur für Verträge, die seit dem 17.12.2009 geschlossen wurden (Art. 28 Rom I-VO); die Rom II-VO gilt für „schadensbegrün-dende“[83] Ereignisse, die seit dem 11.1.2009 eintreten (ungenau Art. 31, 32 Rom II-VO). Die EU-ErbVO gilt für Erbfälle, die seit dem 17.8.2015 eintreten (Art. 83 EU-ErbVO). Art. 75 Abs. 1 EG-UntVO (ab 18.6.2010) und Art. 18 Abs. 1 Rom III-VO (ab 21.6.2012) stellen grundsätzlich auf die Verfahrenseinleitung ab, so dass in am Stichtag anhängigen Fällen altes IPR anwendbar bleibt. Die EU-EheGüterVO und die EU-ELPGüterVO gelten mit Ausnahme einer Rechtswahl nur für Ehen bzw ELPen, die ab[84] dem 29.1.2019 (Art. 69 Abs. 3 EU-EheGüterVO/EU-ELPGüterVO) geschlossen wurden.
419
Deutsche Ehegatten schließen in 2011 einen Ehevertrag, in dem sie deutsches Recht als Scheidungsstatut vereinbaren. Anfang 2012 nehmen sie gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat. Wird Scheidungsantrag vor dem 21.6.2012 bei Gericht eingereicht, so ist diese Rechtswahlvereinbarung vor den zuständigen (Art. 3 Abs. 1 lit. a Str. 1 Brüssel IIa-VO) Gerichten des neuen Aufenthaltsstaates nur gültig, wenn das bisherige dortige IPR die Rechtswahl erlaubt; der ungenau formulierte Art. 18 Abs. 2 Rom III-VO gilt nicht für eine Rechtswahl in Altverfahren. Wurde der Scheidungsantrag ab dem 21.6.2012 anhängig, so erstarkt die bereits vorher geschlossene Rechtswahlvereinbarung, da sie Art. 7 Abs. 1 Rom III-VO (Schriftform) sowie zusätzlich der im deutschen Recht (Art. 7 Abs. 2 Rom III-VO) bestimmten Form des Ehevertrages (Art. 46d Abs. 1) genügt und Art. 18 Abs. 2 Rom III-VO insoweit eine Ausnahme vom Grundsatz der Geltung ab Verfahrenseinleitung macht.
1. Grundregel
420
a) Am 1.9.1986 ist neues IPR (Art. 3 ff) in Kraft getreten. Art. 220 regelt, welches internationale Privatrecht intertemporal anzuwenden ist. Art. 220 Abs. 1 enthält den im deutschen Recht üblichen intertemporalen Grundsatz, dass auf vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossene Vorgänge das bisherige Recht anzuwenden ist. Diese Regelung ist Ausdruck des Vertrauensschutzes. Die Gesetzesänderung soll nicht in Sachverhalte eingreifen, die bereits zu Rechtsfolgen geführt haben.



