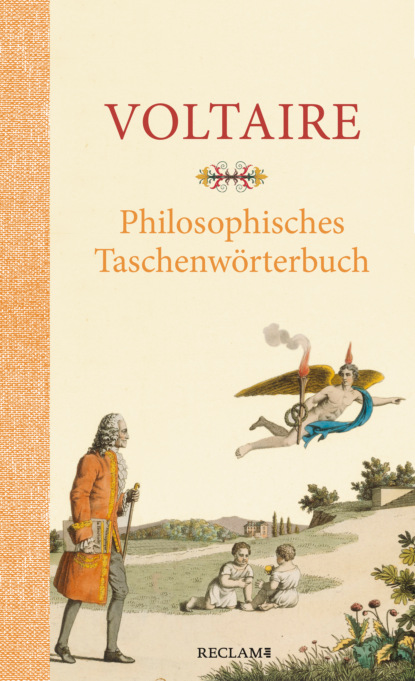
Полная версия:
Philosophisches Taschenwörterbuch
Dieser große Redner sagte in seiner Verteidigungsrede für Cluentius vor dem ganzen versammelten Senat: Welchen Schaden fügt ihm der Tod zu? Wir lehnen all die albernen Märchen über die Unterwelt ab, was hat ihm also der Tod genommen? Nur die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden.
Hält Cäsar, der mit Catilina befreundet war und das Leben seines Freundes vor eben diesem Cicero retten wollte, ihm nicht entgegen, dass es für einen Kriminellen gar keine Strafe ist, wenn man ihn tötet, sondern dass der Tod gar nichts ist außer dem Ende all unserer Übel und eher ein glücklicher Augenblick als ein unheilvoller? Lassen sich Cicero und der ganze Senat nicht von diesen Gründen überzeugen? Die Sieger und die Gesetzgeber der damals bekannten Welt bildeten also offenbar eine Gesellschaft von Menschen, die nichts von den Göttern fürchteten und echte Atheisten waren?
Bayle untersucht als Nächstes, ob der Götzendienst nicht gefährlicher ist als der Atheismus, ob es ein größeres Verbrechen ist, überhaupt nicht an die Gottheit zu glauben, als von ihr unwürdige Vorstellungen zu haben; er teilt, was das anbelangt, die Auffassung von Plutarch, der meint, es sei besser, gar keine Meinung zu haben als eine schlechte. Aber ob es nun Plutarch gefällt oder nicht, es ist offensichtlich, dass es für die Griechen unendlich viel besser war, Ceres, Neptun und Jupiter zu fürchten, als überhaupt nichts zu fürchten. Es ist klar, dass die Heiligkeit des Eides notwendig ist und dass man denjenigen mehr vertrauen muss, die meinen, dass ein Meineid bestraft wird, als denjenigen, die meinen, sie könnten ungestraft einen Meineid schwören. Es ist unbezweifelbar, dass es in einer zivilisierten Stadt unendlich viel nützlicher ist, eine Religion (selbst eine schlechte) zu haben als gar keine.
Es hat den Anschein, als sollte Bayle eher untersuchen, was gefährlicher ist, der Fanatismus oder der Atheismus. Der Fanatismus ist gewiss tausendmal unheilvoller als der Atheismus, denn der weckt keine blutrünstigen Leidenschaften, während der Fanatismus das sehr wohl tut: Der Atheismus hindert zwar niemand daran, ein Verbrechen zu begehen, doch der Fanatismus veranlasst dazu. Nehmen wir mit dem Autor des Commentarium rerum Gallicarum* einmal an, dass der Kanzler de L’Hôpital Atheist war, so hat er doch ausschließlich weise Gesetze gemacht und zu Mäßigung und Einigung geraten. Die Fanatiker begingen die Massaker in der Sankt-Bartholomäusnacht*. Hobbes galt als ein Atheist, er führte ein ruhiges und unschuldiges Leben. Die Fanatiker seiner Zeit jedoch überschwemmten England, Schottland und Irland mit Blut. Spinoza war nicht nur Atheist, sondern lehrte sogar den Atheismus, jedoch war er mit Sicherheit nicht an dem Justizmord an Barneveldt beteiligt, und nicht er war es, der die beiden Brüder de Witt in Stücke reißen ließ und sie dann gegrillt verspeiste.
Die Atheisten sind zumeist kühne und auf Abwege geratene Gelehrte, die nicht die richtigen Schlüsse ziehen und, da sie die Schöpfung, den Ursprung des Bösen und anderer Probleme nicht verstehen können, Zuflucht zur Hypothese von der Ewigkeit der Dinge und der Notwendigkeit nehmen*.
Ehrgeizige und wollüstige Menschen haben kaum die Zeit zum Nachdenken und sich einer schlechten Weltanschauung zu widmen, denn sie haben anderes zu tun, als Lukrez mit Sokrates zu vergleichen. So laufen doch die Dinge heute bei uns.
Das war im römischen Senat nicht so, er bestand fast nur aus Männern, die in Theorie und Praxis Atheisten waren, das heißt also, weder an die Vorsehung noch an ein Leben nach dem Tode glaubten. Dieser Senat war eine Versammlung von Philosophen, Wollüstigen und Ehrgeizigen, die alle sehr gefährlich waren und die den Untergang der Republik herbeiführten.
Ich möchte es nicht mit einem atheistischen Fürsten zu tun haben, in dessen Interesse es wäre, mich in einem Mörser zerstampfen zu lassen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zerstampft würde. Umgekehrt möchte ich es als Herrscher auch nicht mit atheistischen Höflingen zu tun haben, in deren Interesse es läge, mich zu vergiften; ich müsste jeden Tag auf gut Glück ein Gegengift einnehmen. Es ist also für die Fürsten und die Völker unbedingt notwendig, dass die Vorstellung eines höchsten Wesens, das alles erschafft, über alles herrscht, alles rächt, alles belohnt, zutiefst in den Gemütern verankert ist.
Es gibt atheistische Völker, sagt Bayle in seinen Gedanken über den Kometen. Die Kaffern, die Hottentotten, die Tupinambá und viele andere kleine Völkerschaften haben keinen Gott; das kann sein, das bedeutet aber nicht, dass sie einen Gott leugnen, sie leugenen ihn nicht und bejahen ihn nicht, sie haben niemals etwas darüber gehört. Sagt ihnen, dass es einen gibt, sie werden es ohne Weiteres glauben, sagt ihnen, dass alles aus der Natur der Dinge hervorgeht, sie werden es gleichfalls glauben. Zu behaupten, sie seien Atheisten, wäre als Anschuldigung dasselbe, wie wenn man sagte, sie seien Anti-Cartesianer, sie sind weder für noch gegen Descartes. Sie sind echte Kinder, und ein Kind ist weder Atheist noch Deist, es ist nichts dergleichen.
Was können wir aus all dem schließen? Dass der Atheismus für die Regierenden ein sehr gefährliches Monster ist, dass er es ebenfalls für die Gelehrten in ihrem Studierzimmer ist, auch wenn sie ein unschuldiges Leben führen mögen, denn von ihrem Studierzimmer aus können sie vordringen zu denen, die die Macht haben; und dass der Atheismus, obgleich er nicht so unheilvolle Auswirkungen hat wie der Fanatismus, doch fast immer für die Tugend verhängnisvoll ist. Fügen wir vor allem noch hinzu, dass es heute weniger Atheisten gibt als jemals zuvor, seit die Philosophen festgestellt haben, dass es kein lebendes Wesen ohne Keimzelle und keine Keimzelle ohne Bauplan gibt, usw., und dass das Getreide nicht aus der Verwesung entsteht.
Die nicht philosophisch gebildeten Geometer lehnen die Endursache, die causa finalis, ab, aber die wahren Philosophen erkennen sie an, und wie schon ein bekannter Autor sagte, der Religionslehrer verkündet Gott den Kindern, Newton beweist ihn den Gelehrten.
BAPTÊME – Taufe
»Baptême«, das französische Wort für Taufe, kommt aus dem Griechischen und bedeutet »Eintauchen«. Die Menschen, die sich stets von ihren Sinneswahrnehmungen leiten lassen, stellten sich schlicht vor: Was den Körper reinigt, reinigt auch die Seele. Für Priester und Eingeweihte gab es in den ägyptischen Tempeln große unterirdische Becken. Seit undenklichen Zeiten haben sich die Inder im Wasser des Ganges gereinigt, und diese Zeremonie erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Sie wurde von den Hebräern übernommen, hier taufte man alle Fremden, die das jüdische Gesetz annahmen, sich aber nicht der Beschneidung unterziehen wollten. Vor allem Frauen wurden getauft, bei denen man diese Operation, die sie nur in Äthiopien zu erdulden hatten, nicht vornahm. Es war eine Neugeburt, sie verlieh eine neue Seele, ebenso wie in Ägypten. Zu diesem Thema lese man bei Epiphanios, Maimonides und in der Gemara* nach.
Johannes taufte im Jordan und taufte sogar Jesus, der aber niemals jemanden taufte, jedoch geruhte, diese alte Zeremonie zu heiligen. Jedes Zeichen ist für sich genommen unbedeutend, und Gott lässt seine Gnade ruhen auf dem Zeichen, das auszuwählen ihm gefällt. Die Taufe wurde bald zum ersten Ritus und zum Siegel der christlichen Religion. Allerdings waren die ersten fünfzehn Bischöfe von Jerusalem beschnitten, ob sie getauft waren, ist nicht sicher.
In den ersten Jahrhunderten des Christentums missbrauchte man dieses Sakrament; nichts war alltäglicher, als mit der Taufe bis kurz vor dem Tod zu warten. Das Beispiel Kaiser Konstantins beweist dies ziemlich gut. Seine Überlegungen waren die folgenden: Die Taufe reinigt von allem, ich kann also meine Frau, meinen Sohn und alle meine Verwandten umbringen, danach lasse ich mich taufen und komme in den Himmel – was zu tun er tatsächlich nicht verfehlte. Dieses Beispiel war gefährlich; nach und nach wurde dann der Brauch, den Tod abzuwarten, bis man sich in das geweihte Bad begab, abgeschafft.
Die orthodoxe Kirche behielt die Taufe durch Untertauchen stets bei. Die römisch-katholische Kirche ersetzte diese Art der Taufe am Ende des 8. Jahrhunderts durch einfaches Besprengen, als sie ihre Religion nach Gallien und Germanien ausgedehnt und bemerkt hatte, dass die Kinder in kalten Ländern vom Untertauchen sterben konnten. Oft belegte die orthodoxe Kirche sie deswegen mit einem Bann.
Man befragte den heiligen Cyprian, Bischof von Karthago, ob diejenigen, die sich den ganzen Körper nur hatten besprengen lassen, wirklich getauft seien. Er antwortete in seinem 76. Brief, dass »mehrere Kirchen bezweifelten, dass diese Besprengten Christen seien; was ihn selbst betreffe, so denke er, dass sie Christen sind, aber unendlich viel weniger Gnade erlangen als jene, die dem Brauch entsprechend dreimal untergetaucht wurden.«
Bei den Christen war man von dem Moment an eingeweiht, wo man untergetaucht worden war, vorher war man nur ein Taufbewerber. Um eingeweiht zu werden, brauchte man Gewährsleute, Bürgen, die man mit dem Namen bezeichnete, der Paten entspricht, mit dem Ziel, dass die Kirche der Treue der neuen Christen sicher sein konnte und dass die Mysterien nicht verbreitet wurden. Deshalb waren die Heiden in den ersten Jahrhunderten genauso schlecht über die christlichen Mysterien unterrichtet wie die Christen über die Mysterien der Isis und von Eleusis.
Kyrillos von Alexandria drückt sich in seiner Schrift gegen Kaiser Julian folgendermaßen aus: »Ich würde über die Taufe sprechen, wenn ich nicht befürchtete, dass meine Rede jene mitbekommen, die nicht eingeweiht sind.«*
Schon im 2. Jahrhundert begann man, Kinder zu taufen; es war natürlich, dass die Christen wünschten, dass ihre Kinder, die ohne dieses Sakrament verdammt gewesen wären, dieses empfangen sollten. Man beschloss schließlich, es ihnen am Ende des achten Tages zu spenden, weil sie bei den Juden in diesem Alter beschnitten wurden. Die orthodoxe Kirche praktiziert dies immer noch so. Jedoch setzte sich im 3. Jahrhundert der Brauch durch, sich erst zum Zeitpunkt des Todes taufen zu lassen.
Nach den strengsten Kirchenvätern waren jene, die in der ersten Lebenswoche starben, verdammt. Doch im 5. Jahrhundert dachte sich Petrus Chrysologus den Limbus aus, eine Art mildere Hölle, genauer gesagt den Rand oder Vorhof der Hölle, wo die ohne Taufe gestorbenen kleinen Kinder hinkommen, wo auch die Kirchenväter vor Jesu Christi Niederfahrt zur Hölle waren, so dass seither die Ansicht vorherrscht, dass Jesus Christus in den Limbus hinabgefahren sei und nicht in die Hölle.
Es wurde diskutiert, ob ein Christ in den Wüsten Arabiens mit Sand getauft werden könne, dies hat man verneint; ebenso, ob man mit Rosenwasser taufen könne, und man entschied, dass reines Wasser nötig sei, man könne sich aber auch des Sumpfwassers bedienen. Man versteht leicht, dass alle diese Vorschriften von der Weisheit der ersten Seelenhirten abhingen, die sie aufstellten.
BEAU, BEAUTÉ – Schön, Schönheit
Fragen Sie eine Kröte, was Schönheit ist, das Schöne an sich, das to kalon*. Sie wird Ihnen antworten, dass es sein Weibchen ist, mit zwei großen runden Augen, die aus seinem kleinen Kopf hervorquellen, einem breiten und flachen Maul, einem gelben Bauch und einem braunen Rücken. Befragen Sie dann einen Neger aus Guinea, für ihn ist Schönheit eine schwarze ölige Haut, tiefliegende Augen, eine abgeplattete Nase.
Befragen Sie den Teufel, er wird Ihnen erklären, dass es schön ist, ein Paar Hörner, vier Krallen und einen Schwanz zu haben. Wenden Sie sich schließlich an die Philosophen, sie werden Ihnen mit verworrenem Geschwätz antworten, sie brauchen etwas, das dem Wesen nach dem Schönen an sich, dem to kalon, entspricht.
Eines Tages sah ich mir gemeinsam mit einem Philosophen eine Tragödie an. »Wie schön das ist!«, sagte er. »Was finden Sie denn daran schön?«, fragte ich ihn. »Ich finde es schön, weil der Autor mit seinem Werk seinen Zweck erreicht hat«, sagte er. Am nächsten Morgen nahm er ein Medikament ein, das ihm guttat. »Es hat seinen Zweck erreicht«, sagte ich zu ihm, »welch ein schönes Medikament!« Er verstand, dass man nicht sagen kann, dass ein Medikament schön ist, denn um einen Gegenstand schön zu nennen, muss er unsere Bewunderung und unser Wohlgefallen hervorrufen. Er gab zu, dass die Tragödie in ihm diese beiden Gefühle wachgerufen hatte und dass darin das to kalon verborgen war, das Schöne.
Wir machten eine Reise nach England. Dort spielte man das gleiche Stück in einer perfekten Übersetzung, es brachte alle Zuschauer zum Gähnen. »Oh, oh«, sagte er, »das to kalon ist für die Engländer nicht dasselbe wie für die Franzosen. Nachdem er lange darüber nachgedacht hatte, kam er zu dem Schluss, dass der Begriff des Schönen sehr relativ ist, wie auch das, was in Japan als anständig gilt, in Rom unanständig ist, und das, was in Paris Mode ist, ist es in Peking nicht, und er sparte sich die Mühe, eine lange Abhandlung über das Schöne zu verfassen.
BÊTES – Tiere
Wie jämmerlich, wie armselig ist es doch, wenn behauptet wird, die Tiere seien Maschinen, des Erkenntnisvermögens und der Gefühle beraubt, die ihre Handlungen immer auf die gleiche Weise ausführen, nichts lernen, nichts vervollkommnen usw.*!
Was? Dieser Vogel, der sein Nest im Halbkreis baut, wenn er es an einer Mauer befestigt, und im Viertelkreis, wenn er es in einem Winkel baut, und kreisförmig auf einem Baum; macht dieser Vogel alles auf die gleiche Weise? Dieser Jagdhund, den du drei Monate lang abgerichtet hast, weiß er am Ende dieser Zeit nicht mehr, als er vor deinem Unterricht wusste? Der Kanarienvogel, dem du eine Melodie beibringst, wiederholt er diese etwa sofort? Verwendest du nicht eine beträchtliche Zeit darauf, sie ihn zu lehren? Hast du nicht bemerkt, dass er sich irrt und sich korrigiert?
Kommst du deshalb zu dem Urteil, dass ich Gefühle, ein Gedächtnis, Vorstellungen habe, weil ich mit dir spreche? Nun gut, ich rede nicht mit dir; du siehst mich bekümmert bei mir zu Hause eintreten, unruhig nach einem Schriftstück suchen, den Schreibtisch öffnen, wo ich es meiner Erinnerung nach eingeschlossen hatte, es finden, es mit Freude lesen. Daraus schließt du, dass ich das Gefühl des Kummers und das der Freude empfunden, dass ich ein Erinnerungs- und ein Erkenntnisvermögen habe.
Beurteile also genauso diesen Hund, der seinen Herrn verloren hat, der ihn winselnd auf allen Wegen sucht, der aufgeregt ins Haus kommt, unruhig ist, nach unten und nach oben läuft, von Raum zu Raum, der schließlich den Herrn, den er liebt, in seinem Arbeitszimmer findet und diesem durch sein sanftes Bellen, seine Sprünge, seine Liebkosungen, seine Freude bezeigt.
Barbaren bemächtigen sich dieses Hundes, der in seinen Freundschaftsbezeugungen dem Menschen so sehr überlegen ist, nageln ihn auf einem Tisch fest und sezieren ihn bei lebendigem Leibe, um dir die mesaraische Vene* zu zeigen. Du entdeckst in ihm alle die gleichen Organe, die auch dich zur Empfindung befähigen. Antworte mir, Maschinist!* Hat die Natur etwa alle Anlagen zur Empfindung in diesem Tier angelegt, damit es nichts fühlt? Hat es Nerven, um empfindungslos zu sein? Behaupte nun bloß nicht, dass in der Natur solch krasse Ungereimtheiten vorkommen!
Aber die Lehrer der Philosophenschulen fragen, was denn nun die Seele der Tiere ist. Ich verstehe diese Frage nicht. Ein Baum hat die Fähigkeit, in allen seinen Fasern seinen Saft zu empfangen, der darin zirkuliert, er kann die Knospen seiner Blätter und seiner Früchte entfalten. Werdet Ihr mich jetzt fragen, was die Seele dieses Baumes ist?* Er ist mit diesen Fähigkeiten ausgestattet; das Tier hat die der Empfindungsfähigkeit, des Erinnerungsvermögens und eine gewisse Denkfähigkeit erhalten. Wer hat alle diese Gaben geschaffen? Wer hat die Tiere mit allen diesen Fähigkeiten ausgestattet? Derjenige, der das Gras auf den Feldern wachsen und die Erde um die Sonne rotieren lässt.
Die Seelen der Tiere sind substantielle Formen, sagte Aristoteles*, und nach Aristoteles die arabische Schule, und nach der arabischen Schule sagten es die Thomisten, und nach den Thomisten die Sorbonne, und nach der Sorbonne niemand mehr auf der Welt.
Die Seelen der Tiere sind materiell, posaunen andere Philosophen.* Doch diese hatten auch nicht mehr Erfolg als die anderen. Man hat sie vergebens gefragt, was eine materielle Seele ist. Sie müssen zugeben, dass Materie empfindet, doch wer hat ihr diese Empfindungen eingegeben? Materielle Seele heißt, dass es Materie ist, die der Materie Empfindungen verleiht, sie kommen aus diesem Zirkel nicht heraus.
Hört anderen Dummköpfen zu, wie sie über die Tiere urteilen. Nach ihnen ist die tierische Seele ein spirituelles Wesen, das mit dem Körper stirbt. Aber welchen Beweis habt Ihr dafür? Welche Vorstellung habt Ihr von diesem spirituellen Wesen, das eigentlich über Empfindungsfähigkeit, Erinnerungsvermögen und sein Maß an Vorstellungen und deren Kombination verfügt, aber niemals das wissen kann, was ein Kind von sechs Jahren weiß. Womit begründet Ihr die Vorstellung, dass dieses Wesen, das kein Körper ist, mit dem Körper zugrundegeht? Die größten Dummköpfe sind diejenigen, die vorgebracht haben, dass diese Seele weder Körper noch Geist ist. Das ist mir ein schönes System. Wir können uns unter Geist nur etwas Unbekanntes vorstellen, das kein Körper ist. So läuft das System dieser Herren darauf hinaus, dass die Seele der Tiere eine Substanz ist, die weder ein Körper ist noch etwas, das kein Körper ist.
Wo können so viele einander widersprechende Irrtümer bloß herkommen? Doch wohl nur von der Gewohnheit, die die Menschen schon immer hatten, zuerst zu untersuchen, was eine Sache ist, bevor man weiß, ob sie überhaupt existiert. Man nennt das Zünglein, das Ventil eines Blasebalgs die Seele des Blasebalgs. Was ist nun diese Seele? Es ist ein Name, den ich diesem Ventil gegeben habe, das sich senkt, die Luft einlässt, sich wieder aufrichtet und die Luft durch ein Rohr presst, wenn ich den Blasebalg in Bewegung setze.
Dort gibt es überhaupt keine von der Maschine verschiedene Seele. Doch wer bewegt den Blasebalg der Tiere? Ich habe es Euch bereits gesagt, derjenige, der die Sterne sich bewegen lässt. Der Philosoph, der gesagt hat Deus est anima brutorum,* hatte recht: Doch hätte er dabei nicht stehenbleiben sollen.
BIEN. SOUVERAIN BIEN – Das Gute. Das höchste Gut
In der Antike hat man sehr viel über das höchste Gut gestritten; genauso gut hätte man fragen können, was das absolute Blau ist oder das ideale Ragout, die reinste Form des Gehens oder des Lesens usw.
Jeder sieht das Gute dort, wo er vermag, und bekommt so viel davon, wie er – auf seine Art – bekommen kann.
Quid dem, quid non dem, renuis tu quod jubet alter.
Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem pugnis. *
Das höchste Gut ist das, was uns in solchem Ausmaß ergötzt, dass es uns vollständig unfähig macht, noch irgendetwas anderes zu empfinden, ganz so, wie das größte Übel dasjenige ist, das so weit geht, uns aller Gefühle zu berauben. Dies sind die beiden Extreme der menschlichen Natur, und beide dauern sie nur einen kurzen Augenblick.
Es gibt weder extreme Wonnen noch extreme Qualen, die das ganze Leben andauern können: Das höchste Gut und das größte Übel sind beides Trugbilder.
Wir haben dazu die schöne Fabel von Krantor; er lässt den Reichtum, die Wollust, die Gesundheit und die Tugend bei den Olympischen Spielen erscheinen, und sie alle wollen den Apfel* haben. Der Reichtum sagt: »Ich bin das höchste Gut, denn mit mir kauft man alle Güter.« Die Wollust sagt: »Der Apfel gehört mir, denn man will den Reichtum nur haben, um mich zu besitzen.« Die Gesundheit versichert, dass es ohne sie keine Wollust gibt und dass der Reichtum überflüssig ist. Schließlich stellt es die Tugend so dar, dass sie über den drei anderen stehe, denn trotz Gold, Vergnügungen und Gesundheit könne das Leben erbärmlich sein, wenn man sich schlecht verhalte. Die Tugend bekam den Apfel.
Die Fabel ist sehr sinnig, doch ist sie keineswegs eine Antwort auf die absurde Frage nach dem höchsten Gut. Die Tugend ist kein Gut, sie ist eine Pflicht, sie ist von anderer Art, gehört zu einer höheren Ordnung; sie hat nichts mit schmerzvollen oder angenehmen Empfindungen zu tun. Wird der tugendhafte Mensch, den seine Koliken und die Gicht plagen, ohne Unterstützung, ohne Freunde, von einem wollüstigen Tyrannen, dem es seinerseits gut geht, des Notwendigsten beraubt, verfolgt und in Ketten gelegt, so ist er sehr unglücklich. Der unverschämte Verfolger aber, der auf seinem purpurnen Bett seine neue Geliebte streichelt, ist sehr glücklich. Sagen Sie, dass der verfolgte Weise seinem unverschämten Verfolger vorzuziehen ist, dass Sie den einen schätzen und den anderen verabscheuen, aber geben Sie zu, dass der Weise in seinen Ketten rasend wird vor Wut. Wenn der Weise das nicht zugibt, täuscht er uns – und ist ein Schwindler.
TOUT EST BIEN – Alles ist gut
Das gab einen schönen Tumult in den Fakultäten und sogar bei den Leuten, die ihre Vernunft gebrauchen, als Leibniz, Platon paraphrasierend, seine Konstruktion der besten aller möglichen Welten errichtete und sich vorstellte, dass alles zum Besten stehe.* Er saß da im Norden Deutschlands und beteuerte, dass Gott nur eine einzige Welt erschaffen konnte. Platon hatte ihm zumindest die Freiheit gelassen, fünf davon zu erschaffen:* aus dem Grunde nämlich, dass es nur fünf regelmäßige feste Körper gibt, den Tetraeder oder die dreiflächige Pyramide mit gleicher Grundfläche, den Würfel, den Hexaeder, den Dodekaeder, den Ikosaeder. Aber da unsere Welt nicht die Form eines dieser fünf Körper Platons hat, musste er Gott eine sechste erlauben.
Lassen wir nun den göttlichen Platon beiseite. Leibniz, der bestimmt ein besserer Geometer war als er und ein gründlicherer Metaphysiker, erwies also der Menschheit den Dienst, ihr klarzumachen, dass wir sehr zufrieden sein müssen und dass Gott nicht mehr für uns tun konnte, da er notwendigerweise von allen möglichen Lösungen die ausgewählt hatte, die unwidersprochen die beste ist.
»Und was wird dann aus der Erbsünde?«, schrie man ihm entgegen. »Es wird daraus werden, was daraus werden kann«, sagten Leibniz und seine Freunde, aber für die Öffentlichkeit schrieb er, dass die Erbsünde notwendigerweise zur besten aller Welten dazugehöre.*
Was! Man wird aus einem Ort der Freuden verjagt, wo man ewig hätte leben können, wenn man nicht einen Apfel gegessen hätte? Was! Im Elend elende Kinder zeugen, die alles erdulden müssen und andere alles werden erdulden lassen? Was! Alle Krankheiten durchmachen, allen Kummer verspüren, unter Schmerzen sterben und zur Erfrischung eine Jahrhunderte währende Ewigkeit in der Hölle schmoren; ist dieses Los wirklich das Beste, was es gab? Das ist nicht allzu gut für uns; und inwiefern kann das für Gott gut sein?
Leibniz erkannte, dass es darauf keine Antwort gab, deshalb schrieb er dicke Bücher, worin er sich selbst nicht auskannte.
Zu leugnen, dass es das Böse gibt, das kann sich lachend ein Lukullus erlauben, dem es gut geht und der mit seinen Freunden und seiner Geliebten im Apollo-Saal bei einem guten Essen sitzt; aber er braucht nur den Kopf aus dem Fenster zu strecken, da sieht er die Unglücklichen, und wenn er Fieber hat, gehört er selbst zu ihnen.
Ich zitiere nicht gern, normalerweise ist das ein schwieriges Geschäft; man vernachlässigt, was der zitierten Stelle vorausgeht und was ihr folgt, und man setzt sich tausend Streitereien aus. Dennoch muss ich jetzt den Kirchenvater Laktanz zitieren, der in seinem 13. Kapitel von Über den Zorn Gottes Epikur Folgendes sagen lässt: »Entweder will Gott diese Welt von dem Bösen befreien und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es auch nicht, oder schließlich er kann es und will es. Wenn er es will und nicht kann, ist es Ohnmacht, was der Natur Gottes widerspricht; wenn er es kann und nicht will, ist es Bosheit, und das widerspricht seiner Natur nicht weniger; wenn er es nicht will und nicht kann, ist es Bosheit und Ohnmacht zugleich; wenn er es will und kann (was von diesen Möglichkeiten die einzige ist, die auf Gott zutrifft), woher kommt dann das Böse auf der Welt?«*



