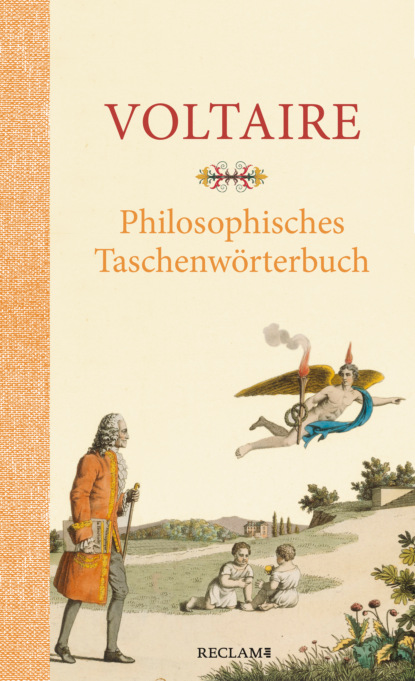
Полная версия:
Philosophisches Taschenwörterbuch
Der Bischof von Cloyne, Berkeley, ist der letzte, der mit hundert trügerischen Sophismen zu beweisen vorgab, dass die Körper nicht existieren; sie haben, so behauptet er, keine Farben, keine Gerüche, keine Temperatur. Diese Eigenschaften gibt es in unseren Empfindungen, aber nicht in den Dingen selbst: Er hätte sich die Mühe sparen können, diese Wahrheit zu beweisen, sie war hinreichend bekannt. Doch von da geht er zur Ausdehnung und Festigkeit über, die zum Wesen des Körpers gehören, und er meint beweisen zu können, dass es in einem Stück grünen Tuches keine Ausdehnung gebe, da dieses Tuch in Wirklichkeit nicht grün sei und diese Empfindung des Grünen nur in uns existiere, weshalb es diese Empfindung der Ausdehnung auch nur in uns geben kann. Und nachdem er auf diese Weise die Ausdehnung zum Verschwinden gebracht hat, schließt er, dass die Festigkeit, die damit verbunden ist, sich von selbst auflöst; und so gibt es nichts anderes auf der Welt als unsere Vorstellungen. Daraus folgt nach diesem Kirchenlehrer, dass zehntausend Menschen, die durch zehntausend Kanonenschüsse getötet wurden, eigentlich nichts anderes sind als zehntausend Ausgeburten unserer Vorstellungskraft.
Es lag also nur in der Hand des Herrn Bischof von Cloyne, die Lächerlichkeit nicht auf die Spitze zu treiben. Er glaubt zu beweisen, dass es keinerlei Ausdehnung gibt, weil ein Körper ihm, als er seine Brille aufhatte, viermal so groß erschien, als wie er ihn mit bloßem Auge wahrnahm, und er erschien ihm wiederum viermal kleiner, wenn er andere Gläser aufsetzte. Daraus schließt er, dass, da ein Körper nicht gleichzeitig vier Fuß, sechzehn Fuß und einen einzigen Fuß Ausdehnung haben kann, diese Ausdehnung nicht existiert, weshalb es nichts dergleichen gibt. Er hätte nur ein Maß zu nehmen brauchen und sagen sollen: »Unabhängig davon, wie groß mir ein Körper auch erscheinen mag, besitzt er eine Ausdehnung von soundso vielen Maßeinheiten.«
Er hätte leicht feststellen können, dass es sich mit der Ausdehnung und der Festigkeit anders verhält als mit den Tönen, den Farben, dem Geschmack und den Gerüchen usw. Es ist klar, dass es sich dabei um die in uns durch die Beschaffenheit der Teile hervorgerufenen Empfindungen handelt, aber die Ausdehnung ist gewiss keine Empfindung. Wenn das brennende Stück Holz erlischt, ist es mir nicht mehr warm; wenn die Luft nicht mehr erschüttert wird, höre ich nichts mehr; wenn diese Rose verwelkt, rieche ich sie nicht mehr; aber dieses Stück Holz, diese Luft, diese Rose haben unabhängig von mir eine Ausdehnung. Das Paradoxon von Berkeley ist nicht der Mühe wert, widerlegt zu werden.
Es ist gut zu wissen, was ihn zu diesem Paradoxon veranlasst hat. Ich habe mich vor langer Zeit mehrfach mit ihm unterhalten. Er sagte mir, seine Auffassung sei darin begründet, dass man nicht begreifen kann, was denn dieser Gegenstand ist, dem man die Eigenschaft, ausgedehnt zu sein, zuschreibt. Und in der Tat trägt er in seinem Buch den Sieg davon, wenn er Hylas fragt, was dieser Gegenstand, dieses Substratum, diese Substanz, eigentlich sei.* »Es ist der ausgedehnte Körper«, erwidert Hylas. Daraufhin macht sich der Bischof, der unter dem Namen Philonous auftritt, über ihn lustig, und der arme Hylas, der merkt, dass er gesagt hat, die Ausdehnung sei der Gegenstand der Ausdehnung, dass er also dummes Zeug geredet hat, ist sehr verwirrt und gibt zu, dass er davon nichts verstehe und dass es überhaupt keine Körper gibt, dass die materielle Welt nicht existiere und es nur eine geistige Welt gibt.
Hylas hätte stattdessen einfach zu Philonous sagen sollen: »Wir wissen nichts über das Wesen dieses Dinges, dieser ausgedehnten, festen, teilbaren, beweglichen, geformten usw. Substanz. Ich kenne sie genauso wenig wie das denkende, empfindende und wollende Subjekt; aber dieses Subjekt existiert deshalb nicht weniger, da es wesentliche Eigenschaften besitzt, die man ihm nicht nehmen kann.«
Uns allen geht es dabei wie den meisten Pariserinnen: Sie essen gerne gut, ohne zu wissen, woraus die Gerichte bestehen. Ebenso erfreuen wir uns an den Körpern, ohne zu wissen, woraus sie sich zusammensetzen. Woraus besteht denn ein Körper? Aus Teilen, und diese Teile teilen sich wiederum in andere Teile auf. Und was sind dann diese letzteren Teile? Immer noch Körper. Wir teilen unaufhörlich und kommen doch nie voran.
Schließlich entdeckte ein scharfsinniger Philosoph, dass ein Gemälde aus Bestandteilen besteht, von denen keiner ein Gemälde ist, und ein Haus aus Materialien, von denen keines ein Haus ist, und stellte sich (auf eine etwas andere Weise) vor, dass die Körper aus unendlich vielen kleinen Wesen bestehen, die keine Körper sind; diese nennt man Monaden.* Dieses System hat manches für sich, und wenn es geoffenbart wäre, würde ich wahrscheinlich daran glauben. Alle diese kleinen Wesen wären mathematische Punkte, eine Art Seelen, die nur auf ein Gewand warteten, um hineinzuschlüpfen. Das wäre eine beständige Seelenwanderung, eine Monade schlüpfte bald in einen Walfisch, bald in einen Baum, dann wieder in einen Falschspieler. Dieses System ist nicht schlechter als andere; ich mag es ebenso gerne wie die Bewegungsabweichungen der Atome, die substantiellen Formen; die versatile Gnade und die Vampire von Dom Calmet.*
DE LA CHINE – Über China
Wir holen Erde aus China, als hätten wir keine, dazu Stoffe, als fehlten uns welche; ein winziges Kräutlein, um es dann mit Wasser aufzugießen, so, als ob wir in unseren Breitengraden keine Heilkräuter hätten.* Zum Lohn dafür wollen wir die Chinesen bekehren,* was zwar ein sehr löblicher Eifer ist, aber man sollte ihnen nicht ihr Altertum wegnehmen wollen und ihnen sagen, dass sie Götzendiener sind.* Fände man es tatsächlich gut, wenn ein Kapuziner, der in einem Schloss der Herzöge von Montmorency freundlich aufgenommen wurde, ihnen einreden wollte, dass sie, ebenso wie die Sekretäre des Königs, zum frischgebackenen Adel gehören, und er sie des Götzendienstes beschuldigte, bloß weil er in ihrem Schloss zwei oder drei Statuen der obersten Heerführer vorfand, denen man tiefen Respekt zollte?
Der berühmte Wolff, Mathematikprofessor an der Universität von Halle, hielt einmal einen sehr guten Vortrag zum Lob der chinesischen Philosophie;* er lobte diese alte Menschenart, die sich von uns durch den Bart, die Augen, die Nase, die Ohren und die Argumentationsweise unterscheidet; er lobte, sage ich, die Chinesen dafür, dass sie einen höchsten Gott verehren und die Tugend lieben; er ließ den Kaisern Chinas Gerechtigkeit widerfahren, den Koalos*, den Gerichten, den Gebildeten. Die Gerechtigkeit, die man den Bonzen zukommen lässt, ist von anderer Art.
Man muss wissen, dass dieser Wolff tausend Studenten aus allen Nationen nach Halle lockte. Es gab aber an der gleichen Universität einen Theologieprofessor namens Lange, der niemanden anlockte; dieser Mann wollte nun, aus Verzweiflung darüber, dass er in seinem Hörsaal alleingelassen vor Kälte erfrieren könnte, aus gutem Grund den Mathematikprofessor beseitigen; er versäumte also nicht, wie es bei Leuten seinesgleichen üblich war, ihn zu beschuldigen, dass er nicht an Gott glaube.
Einige europäische Schriftsteller, die niemals in China gewesen waren, hatten nun behauptet, die Regierung in Peking sei atheistisch. Wolff hatte die Philosophen von Peking gelobt, also war Wolff ein Atheist; Neid und Hass führen niemals zu den besten logischen Schlüssen. Diese Argumentation von Lange, unterstützt von einer Intrige und einem Gönner, wurde vom König des Landes als überzeugend befunden, woraufhin er dem Mathematiker ein jedem philosophischen Dilemma genügendes Schreiben zusandte; dieses Dilemma ließ ihm die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Halle innerhalb von 24 Stunden zu verlassen oder aber gehängt zu werden. Und da Wolff sehr folgerichtig urteilte, verfehlte er nicht abzureisen; seine Amtsaufgabe kostete den König zwei- oder dreihundert Taler pro Jahr, die dieser Philosoph durch den Zustrom seiner Schüler dem Königreich eingebracht hatte.
Dieses Beispiel soll den Herrschern deutlich machen, dass man nicht immer auf Verleumdungen hören und einen großen Mann der Wut eines Dummkopfes opfern sollte. Doch kommen wir zu China zurück.
Was tun wir eigentlich, wenn wir, die wir am Rande des Abendlandes wohnen, uns mit Verbissenheit und Unmengen von Beschimpfungen darüber streiten, ob es vor dem chinesischen Kaiser Fo-hi vierzehn andere Herrscher gab oder nicht, und ob dieser Fo-hi dreitausend oder zweitausendneunhundert Jahre vor unserer gewöhnlichen Zeitrechnung lebte? Ich wünschte mir, dass in Dublin zwei Irländer darauf verfielen, sich darüber zu streiten, wer im 12. Jahrhundert wohl den Grund und Boden besessen hat, der heute mir gehört; ist es nicht einleuchtend, dass sie sich dann an mich wenden müssten, da ich derjenige bin, der die Urkunden in Händen hält? Meiner Meinung nach verhält es sich mit den ersten Kaisern Chinas ebenso, man muss sich an die Gerichte im Lande selbst wenden.
Streitet euch doch so viel ihr wollt über die vierzehn Herrscher, die vor Fo-hi regierten, euer schöner Streit wird letztlich nur beweisen, dass China damals ein sehr volkreicher Staat war und dass dort die Gesetze herrschten. Nun frage ich euch, ob eine so wohlgefügte Nation, die Gesetze und Herrscher hat, nicht ein ungeheures Alter voraussetzt. Denkt einmal darüber nach, wie viel Zeit es braucht, bis das einzigartige Zusammentreffen von Umständen dafür sorgt, dass man die Lagerstätten des Eisens findet, es in der Landwirtschaft anwenden kann, das Weberschiffchen erfindet und alle die anderen Künste.
Diejenigen, die Kinder auf dem Papier zeugen, haben eine sehr lustige Berechnung angestellt. Der Jesuit Petau schätzt die Erdbevölkerung 285 Jahre nach der Sintflut auf hundertmal mehr Bewohner, als man heute anzunehmen wagt. Cumberland und Whiston haben ähnlich seltsame Berechnungen angestellt;* diese guten Leute hätten nichts anderes tun müssen, als sich einmal die Personenstandsregister unserer Kolonien in Amerika anzusehen, sie wären sehr erstaunt gewesen und sie hätten gelernt, wie wenig sich die Menschheit doch vermehrt, und dass sie sehr oft abnimmt, anstatt sich zu vermehren.
Lassen wir also, wir, die wir erst von gestern sind, wir Nachkommen der Kelten, die wir gerade die Wälder unserer wilden Gegend gerodet haben, lassen wir doch die Chinesen und Inder in Frieden ihr schönes Klima und ihr Altertum genießen. Hören wir vor allem auf, den Kaiser von China und den Suba von Dekkan Götzendiener zu nennen;* dazu muss man kein fanatischer Anhänger der Verdienste der Chinesen sein; denn die Verfassung ihres Kaiserreiches ist in Wahrheit die beste, die es auf der Welt gibt, die einzige, die vollständig auf der väterlichen Autorität beruht (was die Mandarine nicht daran hindert, ihren »Kindern« kräftige Stockschläge zu versetzen); es ist die einzige, nach der der Gouverneur einer Provinz bestraft wird, wenn er aus dem Amt scheidet und das Volk ihm nicht zujubelt; die einzige, die Preise für die Tugend ausgesetzt hat, während überall sonst die Gesetze sich damit begnügen, das Verbrechen zu bestrafen; und die einzige, welche ihre Bezwinger dazu brachte, ihre Gesetze zu übernehmen, während wir noch immer den Bräuchen der Burgunder, der Franken und der Goten anhängen, die uns bezwungen haben. Aber man muss zugeben, dass das einfache Volk, das von den Bonzen regiert wird, ebenso spitzbübisch wie bei uns ist, dass man dort den Fremden, genauso wie bei uns, alles so teuer wie möglich verkauft; dass sich die Chinesen in den Wissenschaften auf einem Stand befinden, wo wir vor zweihundert Jahren waren; dass sie wie wir tausend lächerliche Vorurteile haben, dass sie an Talismane und die Voraussagen der Astrologie glauben, wie wir das auch lange Zeit getan haben.
Geben wir auch noch zu, dass sie über unser Thermometer erstaunt waren, über unsere Methode, Flüssigkeiten mit Salpeter zum Gefrieren zu bringen, und über alle Experimente von Torricelli und Otto von Guericke,* ganz so erstaunt, wie wir es waren, als wir zum ersten Mal diesen physikalischen Vorführungen beiwohnten; fügen wir noch hinzu, dass ihre Ärzte nicht mehr tödliche Krankheiten heilen als die unseren und dass in China ebenso wie bei uns die Natur die kleinen Wehwehchen ganz alleine heilt; aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass die Chinesen vor viertausend Jahren, als wir noch nicht lesen konnten, alle die wirklich nützlichen Sachen wussten, mit denen wir uns heute brüsten.
CATÉCHISME CHINOIS – Chinesischer Katechismus
oder
Gespräche zwischen Zisi, einem Schüler des Konfuzius, mit dem Fürsten Gu, Sohn des Königs von Lu, Tributpflichtiger des chinesischen Kaisers Gnenvan, 417 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ins Lateinische übersetzt von Pater Fouquet, ehemals Jesuit. Das Manuskript befindet sich in der Vatikanischen Bibliothek, Nummer 42759.
GU
Was muss ich darunter verstehen, wenn man mir sagt, ich solle den Himmel (Shangdi) anbeten?
ZISI
Das ist nicht der materielle Himmel, den wir sehen; denn dieser Himmel ist nichts anderes als Luft, und diese Luft wiederum setzt sich aus sämtlichen Ausdünstungen der Erde zusammen. Es wäre heller Wahnsinn, Dämpfe anzubeten.
GU
Es würde mich jedoch nicht überraschen. Mir scheint, die Menschen haben noch viel größere Torheiten begangen.
ZISI
Das ist wahr: Doch Sie sind dazu bestimmt, zu regieren, Sie müssen Bescheid wissen.
GU
Es gibt so viele Völker, die den Himmel und die Planeten anbeten!
ZISI
Die Planeten sind nur Erdkugeln wie die unsrige. Der Mond zum Beispiel täte genauso gut daran, unseren Sand und unseren Dreck anzubeten, wie wir vor dem Sand und dem Dreck auf dem Mond auf die Knie gehen.
GU
Was soll es dann heißen, wenn man sagt: Himmel und Erde, zum Himmel aufsteigen, des Himmels würdig sein?
ZISI
Man gibt enormen Unsinn von sich.* Es gibt keinen Himmel. Jeder Planet ist von seiner Atmosphäre wie von einer Schale umgeben und beschreibt im Raum eine Bahn um seine Sonne. Jede Sonne ist das Zentrum mehrerer Planeten, die beständig um sie kreisen. Es gibt keine Höhen und Tiefen, noch ein Aufsteigen oder Absteigen. Sie sehen sicher ein, dass es eine überspannte Äußerung wäre, wenn die Bewohner des Mondes sagen würden, dass sie zur Erde aufsteigen, dass sie sich der Erde würdig erweisen müssen. Wir äußern gleichfalls etwas Sinnloses, wenn wir sagen, dass man sich des Himmels würdig erweisen muss, das ist, wie wenn man sagte: »Man muss sich der Luft würdig erweisen, des Sternbilds Drache, des Weltraums.«
GU
Ich glaube, ich verstehe Sie. Man soll nur den Gott anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat.
ZISI
Gewiss, man soll nur Gott anbeten. Doch wenn wir sagen, dass er Himmel und Erde geschaffen habe, sagen wir gottesfürchtig etwas sehr Dürftiges. Wenn wir unter dem Himmel den gewaltigen Raum verstehen, in dem Gott so viele Sonnen entzündete und so viele Planeten kreisen ließ, ist es sehr viel lächerlicher, vom Himmel und der Erde zu reden, als von den Bergen und einem Sandkorn. Unsere Erdkugel ist unendlich weniger als ein Sandkorn im Vergleich zu diesen Millionen von Milliarden von Welten, unter denen wir verschwinden. Alles, was wir tun können, ist, hier unsere schwache Stimme der Stimme der unzähligen Wesen in der grenzenlosen Weite hinzuzufügen.
GU
Man hat uns also ordentlich hinters Licht geführt, als man uns erzählte, dass Fo* vom vierten Himmel zu uns herabgestiegen und als weißer Elefant erschienen ist.
ZISI
Das sind Märchen, die die Bonzen den Kindern und den alten Weibern erzählen; wir sollen nur den ewigen Schöpfer aller Wesen anbeten.
GU
Doch wie hat ein Wesen die anderen erschaffen können?
ZISI
Betrachten Sie diesen Stern, er ist fünfzehnhunderttausend Millionen Li* von unserem kleinen Erdball entfernt. Es gehen davon Strahlen aus, die von Ihren Augen bis zum Scheitelpunkt zwei gleiche Winkel bilden. Sie bilden mit den Augen aller Tiere ebensolche Winkel. Ist da nicht eine deutliche Absicht bemerkbar? Ist das nicht eine bewundernswerte Gesetzmäßigkeit? Wer erschafft denn nun aber ein solches Werk, wenn nicht ein Schöpfer? Wer macht die Gesetze, wenn nicht ein Gesetzgeber? Es gibt also einen Schöpfer, einen ewigen Gesetzgeber?
GU
Aber wer hat diesen Schöpfer geschaffen? Und wie ist er beschaffen?
ZISI
Mein Fürst, ich bin gestern bei dem ausgedehnten Palast spazieren gegangen, den Ihr Vater, der König, erbaut hat. Ich hörte zwei Grillen, von denen die eine zur anderen sagte: »Das ist ein erstaunliches Bauwerk.« »Ja«, sagte die andere, »so ruhmreich ich auch bin, ich gebe zu, dass derjenige, der dieses Wunderwerk errichtet hat, mächtiger ist als die Grillen; doch ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Wesen. Ich sehe, dass es existiert, aber ich weiß nicht, was es ist.«
GU
Ich sage Ihnen, dass Sie eine weit gebildetere Grille sind als ich, und was mir an Ihnen gefällt, ist, dass Sie nicht vorgeben, etwas zu wissen, wovon Sie keine Ahnung haben.
Zweites Gespräch
ZISI
Sie stimmen also zu, dass es ein allmächtiges Wesen gibt, das aus sich selbst heraus existiert und der über Allem stehende Schöpfer der gesamten Natur ist?
GU
Ja, aber wenn er aus sich selbst heraus existiert, kann ihn also nichts einschränken, er ist demnach überall? Er ist also in der gesamten Materie vorhanden, in allen Teilen meiner selbst?
ZISI
Warum nicht?
GU
Ich wäre demnach selbst ein Teil der Gottheit?
ZISI
Das folgt vielleicht nicht daraus. Dieses Stück Glas wird ganz und gar vom Licht durchdrungen, ist es deshalb selbst Licht? Es ist nur Sand, und weiter nichts. Alles ist zweifellos in Gott, denn was allem Leben verleiht, muss überall sein. Gott ist nicht wie der Kaiser von China, der in seinem Palast wohnt und seine Befehle durch seine Kolaos* übermitteln lässt. Sobald er existiert, erfüllt seine Existenz notwendigerweise den ganzen Raum und alle seine Werke, und da er in Ihnen ist, ist das eine beständige Mahnung, nichts zu tun, für das Sie vor ihm erröten müssten.
GU
Was muss man tun, um es noch wagen zu können, sich ohne Abscheu vor sich selbst und ohne Scham vor dem höchsten Wesen anzusehen?
ZISI
Gerecht sein.
GU
Und was noch?
ZISI
Gerecht sein.
GU
Aber die Sekte des Laotse sagt, dass es weder Gerechte noch Ungerechte gibt, weder Laster noch Tugend.
ZISI
Sagt die Sekte des Laotse auch, dass es keine Gesundheit und keine Krankheit gibt?
GU
Nein, einen so einen großen Irrtum äußert sie keineswegs.
ZISI
Der Irrtum, zu denken, es gebe weder die Gesundheit der Seele noch die Krankheit der Seele, weder Tugend noch Laster, ist ebenso groß und noch verhängnisvoller. Diejenigen, die gesagt haben, dass alles das Gleiche sei, sind Monster. Ist es denn das Gleiche, seinen Sohn zu nähren oder ihn auf dem Stein zu zerquetschen? Seiner Mutter Hilfe zu leisten oder ihr einen Dolch ins Herz zu stoßen?
GU
Sie machen mich schaudern, ich verabscheue die Sekte des Laotse; aber es gibt so viele Abstufungen von Recht und Unrecht! Da ist man häufig sehr unsicher. Welcher Mensch weiß genau, was erlaubt oder was verboten ist? Wer kann schon mit Sicherheit Grenzen ziehen, die das Gute vom Bösen trennen? Welche Regel können Sie mir angeben, um sie voneinander zu unterscheiden?
ZISI
Die des Konfuzius, meines Meisters: Lebe, wie du gelebt haben möchtest, wenn du stirbst; behandele deinen Nächsten, wie du willst, dass er dich behandelt.*
GU
Diese Maximen, das gebe ich zu, sollten der Moralkodex der Menschheit sein. Aber was wird mir im Augenblick des Todes daran liegen, richtig gelebt zu haben? Was werde ich damit gewinnen? Wird diese Uhr, wenn sie einst zerstört wird, glücklich sein, die Stunden gut geschlagen zu haben?
ZISI
Diese Uhr fühlt nicht, denkt nicht, sie kann keine Gewissensbisse haben, und Sie haben welche, wenn Sie sich schuldig fühlen.
GU
Doch was ist, wenn es mir gelingt, nachdem ich mehrere Verbrechen begangen habe, keine Gewissensbisse mehr zu haben?
ZISI
Dann wird man Sie umbringen müssen, und seien Sie sicher, dass sich unter den Leuten, die es nicht mögen, wenn man sie unterdrückt, welche finden werden, die Sie außer Stande setzen, neue Verbrechen zu begehen.
GU
So wird also Gott, der in ihnen ist, ihnen erlauben, böse zu sein, nachdem er mir erlaubt hatte, es zu sein?
ZISI
Gott hat Ihnen die Vernunft gegeben, missbrauchen Sie sie nicht, weder Sie noch die anderen. Sie werden nicht nur in diesem Leben unglücklich sein, denn wer hat Ihnen gesagt, dass Sie es dann nicht noch in einem anderen sein werden?
GU
Und wer hat Ihnen gesagt, dass es ein anderes Leben gibt?
ZISI
Auch im Zweifel sollten Sie sich so verhalten, als ob es eines gäbe.
GU
Aber wenn ich sicher bin, dass es überhaupt keines gibt?
ZISI
Das beweisen Sie mir erst einmal.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



