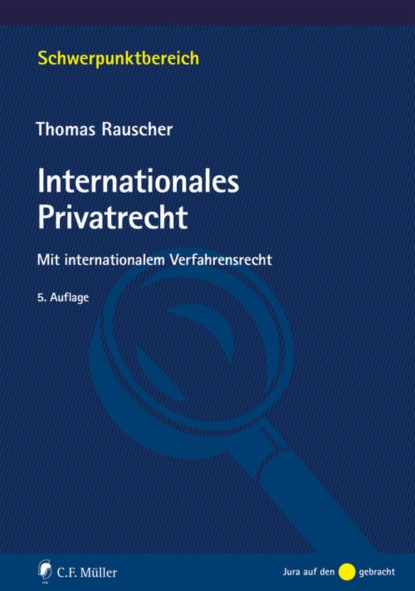
Полная версия:
Internationales Privatrecht
BGBl. 2013 I 101 (Anpassung an Rom III-VO).
[52]
BGBl. 2015 I 1042 (Anpassung an EU-ErbVO).
[53]
Vgl zuletzt BGBl. 2011 I 898, 917: Hinweis auf die EG-UntVO in Art. 3 Nr 1 lit. c.
[54]
V. 5.12.1975 GBl DDR 1975 I 748.
[55]
IdF AHK-Gesetz Nr 48, AHK ABl. 140 sowie 808.
[56]
BGBl. 1951 I 269.
[57]
BGBl. 1969 I 1067.
[58]
Zur Anwendung in Altfällen BGH BeckRS 2016, 11935.
[59]
Referentenentwurf eines Gesetzes zum Internationalen Privatrecht der Gesellschaften, Vereine und juristischen Personen vom Januar 2008.
[60]
Rauscher NJW 2016, 3493, 3499.
[61]
V. 2.10.1997, BGBl. 1998 II 387, BGBl. 1999 II 416.
[62]
BGBl. 1972 II 774 mit vier Beitrittsübereinkommen, zuletzt v. 29.11.1996, BGBl. 1998 II 1412.
[63]
BGBl. 1986 II 810.
[64]
Zur Reichweite der Kompetenz Wagner IPRax 2007, 290.
[65]
Die Methode der Verweisung auf ein Haager Abkommen, dem die EU angehört, erspart redundante Regelungen und fördert mittelbar die Verbreitung des Haager Unterhaltsprotokolls und der hierdurch bewirkten Kollisionsrechtsvereinheitlichung auf völkervertraglichem Weg, dazu Rn 95 f.
[66]
Die Bezeichnung ist, anders als für Rom I und Rom II (vgl dort die Überschriften) inoffiziell.
[67]
Die Bezeichnung als „Rom V“ wäre international gut verständlich, ist aber systematisch schwierig, weil die VO neben IPR (= Rom) auch IZPR (= Brüssel) umfasst.
[68]
Für eine Übergangszeit bis 31.10.2014 bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach Art. 3 Abs. 3, 4 Protokoll Nr 36, ABl. EU 2010 C 83/322; zwischen dem 1.11.2014 und dem 31.3.2017 kann zu dieser Übergangsregelung jedes Mitglied des Rates optieren (Art. 3 Abs. 2 Protokoll Nr 36). Uneingeschränkt gelten damit Art. 16 Abs. 4 EUV, Art. 238 Abs. 3, 4 AEUV somit erst ab dem 1.4.2017.
[69]
EuGH Rs. C-345/06 ECLI:EU:C:2009:140 (Gottfried Heinrich).
[70]
BVerfGE 73, 339.
[71]
EuGH Rs. C-205/06 ECLI:EU:2009:118 (Kommission/Österreich).
[72]
RGBl. 1930 II 748.
[73]
RGBl. 1930 II 1002; wieder anwendbar seit 4.11.1954, BGBl. 1955 II 829.
[74]
BGBl. 1956 II 488.
[75]
Vgl Jayme/Hausmann18 Nr 134 Fn 3.
[76]
Zum jeweils aktuellen Stand aller Vertragsstaaten siehe http://www.hcch.net. Zu den jeweiligen Abkommen finden sich dort: Text, status table mit Zeichnungs- und Ratifikationsstand.
[77]
Das Haager Unterhaltsstatutprotokoll war zunächst nur kraft Verweisung in Art. 15 EG-UntVO innerhalb der EU (als EU-Recht) anwendbar und ist völkerrechtlich seit 1.8.2013 in Kraft.
[78]
EuGH-Gutachten ECLI:EU:C:2014:2303 betreffend Beitritt von Drittstaaten zum HKiEntÜ.
[79]
Kritisch Wagner NJW 2016, 1774, 1776.
[80]
Die Türkei ist seit 1.2.2017 Vertragsstaat des KSÜ: www.hcch.net, Convention Nr 34, Status Table; lesenswert der erklärte Zypern-Vorbehalt.
[81]
RGBl 1933 II 377.
[82]
RGBl 1933 II 537.
[83]
BGBl. 1953 II 559; BGBl. 1969 II 1294.
[84]
Ein solcher Vorbehalt muss im Abkommen zugelassen und völkerrechtlich wirksam bei der Ratifikation erklärt sein. Für die Haager Übereinkommen listet die Seite www.hcch.net alle erklärten Vorbehalte im status table zu dem jeweiligen Abkommen.
[85]
Palandt/Thorn Art. 3 Rn 12; v. Bar/Mankowski I § 3 Rn 99.
[86]
Jayme IPRax 1986, 266; Staudinger/Hausmann (2013) Art. 3 Rn 32 f.
[87]
BGBl. 2011 I 898, 917.
[88]
Die Website des Verfassers www.euzpr.eu bietet einen aktuellen Überblick über sämtliche Verordnungen des EuZPR samt den zugehörigen Materialien der EU-Gesetzgebungsorgane.
[89]
Die Kurzbezeichnungen der Verordnungen sind teilweise nicht offiziell; es besteht mangels offizieller Abkürzungen eine bedauerliche Abkürzungsverwirrung, vor allem aber unterschiedliche Usancen in den Mitgliedstaaten. „Brüssel I“ und „Brüssel II“ sind aus der Bezeichnung „Brüsseler Übereinkommen“ (Brüsseler EuGVÜ) abgeleitete, inzwischen auch von den Organen der EU, zB in Art. 1 Abs. 1 des Anwendungsabkommens mit Dänemark (dazu Rn 1652) verwendete Begriffe. „Rom I“ und „Rom II“, die auf das Römische EVÜ zurückgehen, werden dagegen offiziell im Titel der Verordnungen verwendet.
[90]
Welche die Brüssel I-VO (VO EG 44/2001 ABl. EG 2001 L 12/1) für seit 10.1.2015 eingeleitete Verfahren ersetzt, weshalb die Brüssel I-VO weiter für die Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen aus früheren Verfahren gilt.
[91]
Welche die Brüssel II-VO (VO EG 1347/2000, ABl. EG 2000 L 160/37) seit 1.5.2005 ersetzt.
[92]
Welche die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung in Unterhaltssachen dem bisherigen Anwendungsbereich der Brüssel I-VO und der Brüssel Ia-VO entzieht.
[93]
Welche die EG-ZustellVO 2000 (VO EG 1347/2000, ABl. EG 2000 L 160/90) seit 13.11.2008 ersetzt.
[94]
Zu einem Vorschlag vgl Rauscher FS Machacek/Matscher (2008), 665.
[95]
Protokoll über die Position Dänemarks zum EGV (1997) ABl. EG 1997 C 340/101.
[96]
Teilnahmeerklärung gemäß Art. 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands zum EGV (1997), ABl. EG 1997 C 340/99.
[97]
Gemäß Anhang Art. 3 des Protokolls über die Position Dänemarks idF des Vertrages von Lissabon (ABl. EU 2007 C 306/165, 189) hat Dänemark die bisher nicht genutzte Möglichkeit, sich für die Option zu entscheiden.
[98]
Abkommen vom 19.10.2005 ABl. EU 2005 L 299/61, ABl. EU 2007 L 94/70.
[99]
Schreiben an die Kommission vom 20.12.2012, dazu ABl. EU 2013, L 79/4.
[100]
Bisher zur Anwendung der EG-ZustellVO ab 1.7.2007: Abkommen vom 19.10.2005 ABl. EU 2005 L 300/55, ABl. EU 2007 L 94/70; erstreckt auf die EG-ZustellVO 2007: ABl. EU 2008 L 331/21.
[101]
Für den aktuellen Stand ist der Europäische Gerichtsatlas in Zivilsachen hilfreich (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm).
[102]
ABl. EU 2007 L 339/3; es gilt im Verhältnis zu Norwegen seit 1.1.2010; zur Schweiz seit 1.1.2011; zu Island seit 1.5.2011.
[103]
BGBl. 1977 II 1453.
[104]
BGBl. 1977 II 1472.
[105]
Vgl BGH NJW 2016, 2322: Eintragung zweier in Ehe nach südafrikanischem Recht verbundener Frauen als Eltern unter südafrikanischem Abstammungsrecht im deutschen Geburtenbuch.
[106]
Vgl BGHZ 203, 350: Anerkennung einer kalifornischen Entscheidung, die zwei in ELP verbundene Männer als Väter feststellt.
[107]
Ob der EuGH Rs. C-148/02 ECLI:EU:C:2003:539 (Avello) das Anerkennungsprinzip im Namensrecht etabliert hat, war umstritten, eingehend Coester-Waltjen IPRax 2006, 392, 396; zuletzt zu Art. 48: EuGH Rs. C-438/14 ECLI:EU:C:2016:401 (Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff/Standesamt der Stadt Karlsruhe) mit weiteren Zitaten.
[108]
EuGH Rs. C-353/06 ECLI:EU:C:2008:559 (Stefan Grunkin u.a/Standesamt Niebüll).
[109]
KG NJW 2011, 535; ebenso schon Henrich IPRax 2005, 422, 423 f.
[110]
Grünbuch Weniger Verwaltungsaufwand für EU-Bürger vom 14.12.2010, KOM (2010) 747; dazu Wiss. Beirat des Bundes der Standesbeamten StAZ 2011, 165.
[111]
BGH NJW-RR 2002, 1359, 1360; BGH NJW 2014, 1244.
[112]
BGBl. 1974 II 938, 1975 II 300.
[113]
Beachtlich ist hingegen die Entwicklung der im Internet verfügbaren Quellen, die in manchen Staaten nicht nur vollständige kostenfreie Gesetzessammlungen, sondern auch Gerichtsentscheidungen umfassen und die auch rechtsvergleichend interessierten Studierenden zu empfehlen sind.
[114]
BGH NJW 1991, 1418: Streit um die Richtigkeit eines Gutachtens zu venezolanischen Schiffspfandrechten: „Der vorliegende Fall weist aber Besonderheiten auf, die dem BerGer. Anlaß geben mussten, von den ihm von dem Kl. aufgezeigten weiteren Erkenntnismöglichkeiten Gebrauch zu machen... Auf das Gutachten des Max-Planck-Instituts konnte es sich bei der Klärung dieser Frage nicht stützen. Der Verfasser desselben hat nämlich bei seiner Anhörung selbst angegeben, erstmals einen Fall aus dem venezolanischen Recht begutachtet zu haben und über keinerlei spezielle Kenntnisse dieses Rechts und vor allem der dort bestehenden Rechtspraxis zu verfügen. Danach hat er sich letztlich auf die Auswertung der ihm zugänglichen Literatur und die Auslegung der einschlägigen Gesetze beschränkt. Das reichte für die Ermittlung des ausländischen Rechts nicht aus.“.
[115]
BGH NJW 2014, 1244; BGH NJW 2013, 3656; MüKoZPO/Krüger (5. Aufl., 2016) § 545 Rn 11; aA Hess/Hübner NJW 2009, 3132.
[116]
BGH NJW 2002, 3335.
[117]
So scheiterte die EU-EheGüterVO am Dissens um die implizite Anerkennung gleichgeschlechtlicher Verbindungen durch die EU-ELPGüterVO.
[118]
Hier trifft zB die kontinentaleuropäische Sicherung nächster Angehöriger durch Pflichtteil oder réserve (Noterbrecht) auf die fundamental der Testierfreiheit verschriebene des common law.
[119]
Das europäische Konzept des materiell-rechtlich und statt seiner klagenden Verbände geschützten Verbrauchers trifft hier auf das US-Prinzip des prozessual wehrhaft mit Sammelklage, Jury-trial, punitive damages (Strafschadensersatz) und einem risikoarmen Kostenrecht (contingency fee agreement = Erfolgshonorarvereinbarung mit dem Anwalt) ausgestatteten Verbrauchers, der marktkontrollierende Funktion ausübt.
[120]
BGBl. 1989 II 588, BGBl. 1990 II 1699.
[121]
Große Verbreitung hat zB der Uniform Commercial Code (UCC), den alle 50 US-Bundesstaaten implementiert haben, wenn auch mit Abweichungen insbesondere bei jüngeren Änderungen (Amendments).
[122]
Richtlinie vom 25.10.2011 über die Rechte der Verbraucher usw, ABl. EU 2011 L 304/64.
Teil II Allgemeine Lehren des IPR
Inhaltsverzeichnis
§ 2 Kollisionsnorm
§ 3 Verweisung
§ 4 Qualifikation
§ 5 Erstfrage, Vorfrage und Substitution
§ 6 Korrektur der Verweisung
Teil II Allgemeine Lehren des IPR › § 2 Kollisionsnorm
§ 2 Kollisionsnorm
Inhaltsverzeichnis
A. Kollisionsnormen und Sachnormen
B. Typen von Kollisionsnormen
Teil II Allgemeine Lehren des IPR › § 2 Kollisionsnorm › A. Kollisionsnormen und Sachnormen
I. Begriff
159
Der Begriff „Kollisionsnorm“ wird im Sprachgebrauch des IPR als Überbegriff für alle Normen verwendet, die Verweisungs- oder Anknüpfungsregeln enthalten. Kollisionsnorm ist damit jede Norm des Kollisionsrechts. Kollisionsrecht ist die Gesamtheit aller Normen, die sich mit der Auswahl einer von mehreren in Betracht kommenden materiellen Rechtsordnungen befassen, wobei der Konflikt internationaler, interlokaler, interpersonaler oder intertemporaler Natur sein kann.
II. Struktur
160
Die Struktur der Kollisionsnormen ist nicht einheitlich. Auf der Tatbestandsseite können Sammelbegriffe für Sachverhalte (Systembegriffe, Qualifikationsgruppen) oder bestimmte Verweisungssituationen (dazu Rn 168) stehen.
161
Art. 13 Abs.1 regelt tatbestandlich die Voraussetzungen der Eheschließung, Art. 5 Abs. 1 regelt tatbestandlich die Situation einer Verweisung auf Heimatrecht, wobei die betroffene Person mehrere Heimatrechte hat. Art. 4 Abs. 1 setzt tatbestandlich eine Verweisung auf das Recht eines anderen Staates voraus und bestimmt als Rechtsfolge die Anwendung auch des IPR dieses Staates (sog Gesamtverweisung).
162
Allen Kollisionsnormen gemeinsam ist, dass auf der Rechtsfolgenseite eine Rechtsanwendungsregel steht, nicht aber eine unmittelbare Rechtsfolge. Wie konkret diese ist, ob insbesondere bereits eine anwendbare Rechtsordnung bezeichnet wird, hängt vom Typus der Norm als selbständige oder unselbständige Kollisionsnorm ab.
163
Auf der Rechtsfolgenseite führen also alle drei genannten Normen noch nicht zur materiellen Lösung des Falles. Die erste bestimmt die anwendbare Rechtsordnung, die zweite bestimmt die anwendbare Rechtsordnung unter der Prämisse einer sonstigen Kollisionsnorm, während die letzte auch in Verbindung mit einer weiteren deutschen Kollisionsnorm nur einen weiteren Schritt auf dem Weg zur anwendbaren Rechtsordnung vorsieht.
III. Sachnormen
164
Sachnormen (oder Sachvorschriften, Art. 3a Abs. 1) sind dagegen Normen des materiellen Rechts, deren Tatbestand einen rechtlich relevanten Sachverhalt beschreibt und deren Rechtsfolge unmittelbar die Rechtslage beeinflusst. Wird aus Sicht des IPR von „materiellem Recht“ gesprochen, so bedeutet dies nicht wie sonst materielles Recht in Abgrenzung zu Prozessrecht oder Formvorschriften. Materielles Recht als Gegenbegriff zu Kollisionsrecht wird synonym für die Gesamtheit aller Sachnormen verstanden, umfasst also neben dem materiellen Zivilrecht auch dessen Formvorschriften sowie die Zivilverfahrensordnungen.
IV. Doppelfunktion
165
Ausnahmsweise kann eine Norm sowohl die Funktion einer Kollisionsnorm als auch einer Sachnorm haben. Erfasst eine Norm tatbestandlich einen Fall mit Auslandsbezug, ordnet sie jedoch auf der Rechtsfolgenseite eine bestimmte materielle Rechtsfolge an, so kommt ihr diese Doppelfunktion zu: Einerseits ist sie Kollisionsnorm, denn sie schließt die kollisionsrechtliche Suche nach der anwendbaren Rechtsordnung aus, indem implizit durch die Bestimmung der Rechtsfolge gesagt ist, dass hierüber nicht ein anderes Statut entscheidet. Gleichzeitig ordnet sie als Sachnorm eine materielle Rechtsfolge an. Zu dieser Kategorie gehören häufig materielle Normen für internationale Sachverhalte und materielle Normen des IPR.
166
Nach Art. 17 Abs. 2 kann im Inland eine Ehe nur durch ein Gericht geschieden werden; das schließt die Anwendung des Scheidungsstatuts (vor und nach Inkrafttreten der Rom III-VO am 21.6.2012) teilweise aus, wenn es eine Privatscheidung erlaubt,[1] sofern die Scheidung im Inland erfolgt (insoweit Kollisionsnorm) und ordnet zugleich (unabhängig von der Zulässigkeit einer rechtsgeschäftlichen Scheidung nach dem Scheidungsstatut) ein bestimmtes Verfahren (Scheidung durch Gericht) an (insoweit Sachnorm wie § 1564 S. 1 BGB, der aber keine Kollisionsnorm enthält, sondern nur dann gilt, wenn deutsches Recht Scheidungsstatut ist). Hingegen ist § 1944 Abs. 3 BGB eine Sondernorm für Auslandsfälle, die nur Sachnormcharakter hat: § 1944 Abs. 3 setzt die Anwendung deutschen Rechts als Erbstatut voraus, regelt aber materiell die Ausschlagungsfrist abweichend, wenn die genannten Auslandsbezüge bestehen.
Teil II Allgemeine Lehren des IPR › § 2 Kollisionsnorm › B. Typen von Kollisionsnormen
B. Typen von Kollisionsnormen
167
Innerhalb der Kollisionsnormen werden zahlreiche Kategorien unterschieden; teilweise erlauben diese Kategorien eine komplementäre Aufteilung der Bestimmungen des IPR und ziehen praktische Folgerungen nach sich. Oft beschreiben sie jedoch nur bestimmte Typen von Regelungsstrukturen, ohne dass sich aus der jeweiligen Einordnung einer Norm Folgerungen ergeben. Dann handelt es sich nur um fachsprachliche Konvention, mittels derer über einen bestimmten Normtyp gesprochen wird, dh die Bedeutung mancher der nachfolgenden vieldiskutierten und -umstrittenen Begriffe erschöpft sich – ohne praktische Relevanz – in der akademischen Erkenntnis, dass es diesen Normtypus gibt.
I. Selbständige und unselbständige Kollisionsnormen
168
1. Selbständige Kollisionsnormen bezeichnen in ihrer Rechtsfolge die Rechtsordnung, welche auf den im Tatbestand beschriebenen Sachverhalt anwendbar ist. Sie gehören immer zum Besonderen Teil des IPR (ua Art. 7 ff).
Art. 10 Abs. 1 erklärt als Rechtsfolge das Recht des Staates, dem die Person angehört, für anwendbar. Tatbestand ist der Name der Person.
169
2. Unselbständige Kollisionsnormen bezeichnen hingegen nicht ohne Einschaltung einer weiteren Kollisionsnorm das anwendbare Recht; sie sind Hilfsnormen, welche die Anwendung des Kollisionsrechts ergänzend regeln. Sie stehen häufig im Allgemeinen Teil des IPR, da sie meist ohne Bezug auf bestimmte Systembegriffe den Umgang mit Verweisungen präzisieren.
Art. 4 Abs. 1 S. 1 setzt die Verweisung durch eine andere (selbständige) Kollisionsnorm voraus und legt die Verweisung in dem Sinn aus, dass sie auf das fremde IPR zu beziehen ist. Art. 5 Abs. 1 setzt eine Heimatrechtsverweisung voraus und löst den Konflikt, der entsteht, wenn das Subjekt der Anknüpfung mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt. In beiden Fällen spielt es keine Rolle, ob im konkreten Fall das Namensstatut, das Ehegüterstatut etc zu ermitteln ist.
170
3. Unselbständige Kollisionsnormen sind nicht weniger wichtig als selbständige. Da unselbständige Kollisionsnormen immer im Zusammenwirken mit wenigstens einer selbständigen Kollisionsnorm Anwendung finden, hängt natürlich auch das richtige Ergebnis der Anwendung einer selbständigen Kollisionsnorm vom Inhalt anderer Kollisionsnormen ab, ist also nicht eigentlich „selbständig“. Man kann deshalb auch von unmittelbaren Verweisungsnormen und sonstigen Anknüpfungsregeln sprechen.
Ist eine Vertragspartei Österreicher und Deutscher, so gibt die „selbständige“ Kollisionsnorm des Art. 7 Abs. 1 nicht wirklich das auf die Geschäftsfähigkeit anwendbare Recht an; ohne die Anknüpfungsregel des Art. 5 Abs. 1 ist eine Entscheidung zwischen dem deutschen und dem österreichischen Recht nicht möglich.
1. Entstehung
171
Die historische Entwicklung, die das IPR im 19. Jahrhundert von der Statutenlehre zum Sitz des Rechtsverhältnisses genommen hat, führte aus theoretischer Sicht zu der Notwendigkeit, dass jeder Staat nicht mehr nur die Geltung eigener Normen, sondern den Schwerpunkt beliebiger Rechtsverhältnisse hätte regeln müssen. Für das Erbstatut lautet zB die Grundstruktur der Verweisungsnorm aus Sicht der Statutenlehre „deutsches Erbrecht gilt, wenn...“; aus Sicht der Savignyʼschen Sitzlehre hingegen „ein Erbfall untersteht dem Recht des Staates....“. Dem damit naheliegenden Schritt zur Universalität der Kollisionsnormen stand im 19. Jahrhundert ein Souveränitätsverständnis entgegen, das Bestimmungen über die Anwendbarkeit einer ausländischen Rechtsordnung zwar nicht als verbotenen Eingriff in fremde Souveränität, wohl aber als unschicklich im Verhältnis zur fremden Souveränität erscheinen ließ.
2. Einseitige/allseitige Kollisionsnorm
172
Die am 1.1.1900 in Kraft getretene Fassung des EGBGB enthält daher zahlreiche einseitige Kollisionsnormen. Solche Normen folgen zwar der Savignyʼschen Struktur, bestimmen aber das anwendbare Recht als den Schwerpunkt des Rechtsverhältnisses nur dann, wenn der Sachverhalt engen Bezug zur deutschen Rechtsordnung hat. Unter der damals weitgehenden Geltung des Staatsangehörigkeitsprinzips bedeutete Einseitigkeit der Kollisionsnorm regelmäßig die Beschränkung auf Fälle, in denen das Anknüpfungssubjekt ein Deutscher war.
Art. 24 Abs. 1 bestimmte bis 1986: „Ein Deutscher wird, auch wenn er seinen Wohnsitz im Auslande hatte, nach den deutschen Gesetzen beerbt.“
173
Allseitig ist hingegen eine Kollisionsnorm, die mit Bezug zu einem Rechtsverhältnis das anwendbare Recht aufgrund abstrakter Kriterien (Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt etc) beschreibt, ohne sich auf bestimmte Konstellationen dieses Kriteriums (zB deutsche Staatsangehörigkeit) zu beschränken. Eine allseitige Kollisionsnorm ist also auf alle denkbaren Konstellationen anwendbar.
Art. 25 Abs. 1 idF des IPR-NeuregelungsG 1986 (Rn 176) lautete: „Die Rechtsnachfolge von Todes wegen unterliegt dem Recht des Staates, dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes angehört“. Ebenso allseitig bestimmt Art. 21 Abs. 1 EU-ErbVO: „… unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.“
3. Vervollständigung/Verallseitigung
174
a) Da auch unter altem Kollisionsrecht Fälle vorhersehbar waren, die von einer einseitigen Kollisionsnorm nicht erfasst, dennoch aber von deutschen Gerichten zu entscheiden sein würden, wählte der Gesetzgeber ergänzend einen zwischen der einseitigen und der allseitigen Kollisionsnorm stehenden Zwischentypus, die unvollständig allseitige Kollisionsnorm. Solche (Verweisungs-)Normen bestimmten das anwendbare Recht in Fällen, in denen zwar ein Ausländer betroffen war, jedoch ein offenbarer Bezug zu Deutschland bestand.
Art. 25 Abs. 1 (1900) bestimmte: „Ein Ausländer, der zur Zeit seines Todes seinen Wohnsitz im Inland hatte, wird nach den Gesetzen des Staates beerbt, dem er zur Zeit seines Todes angehörte.“ Art. 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 aF ergaben zusammen eine unvollkommen allseitige Kollisionsnorm, die sich nicht auf Ausländer mit letztem Wohnsitz im Ausland bezog.
175
b) Wo die vorhandenen einseitigen oder unvollkommen allseitigen Kollisionsnormen den zu entscheidenden Fällen nicht genügten, baute die Rechtsprechung diese zu allseitigen Kollisionsregeln aus. Diese Verallseitigung durch Fortentwicklung der in der geschriebenen Kollisionsnorm enthaltenen Idee der Schwerpunktbestimmung war deshalb nicht zweifelhaft, weil der Gesetzgeber ohne kollisionsrechtlichen Grund – aus Rücksicht auf Souveränität – auf eine allseitige Regelung verzichtet hatte.



