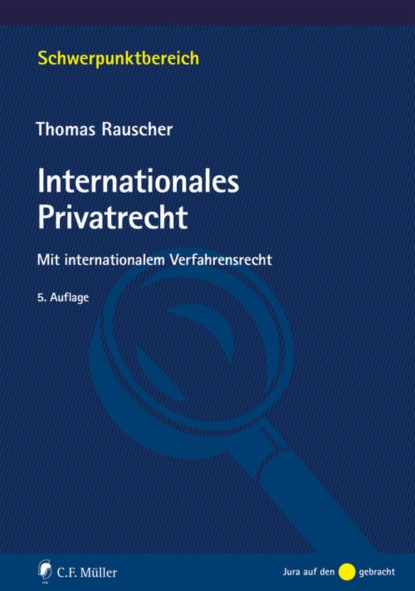
Полная версия:
Internationales Privatrecht
Literatur:
zur historischen Entwicklung: Staudinger/Bausback (2013) Anh II zu Art. 5 EGBGB Rn 1 ff; zum geltenden Staatsangehörigkeitsrecht dort Rn 85 ff.
1. Gewöhnlicher Aufenthalt
273
a) Die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt hat sich im deutschen IPR zum zweiten wichtigen Anknüpfungskriterium entwickelt. Im Gegensatz zur Staatsangehörigkeit ist der gewöhnliche Aufenthalt häufig hilfsweises Anknüpfungskriterium, wo die Staatsangehörigkeit als solches versagt (zB in Art. 14 Abs. 1). Zunehmend wird jedoch dem gewöhnlichen Aufenthalt als einem räumlichen Bezugsschwerpunkt der Person ein eigenständiger primärer Gerechtigkeitsgehalt beigemessen. Diese Wertung geht aus von Haager Übereinkommen (Art. 1, 2 MSA, Art. 5, 15 Abs. 1 KSÜ, Art. 4 Abs. 1 HUntStÜbk 1973, Art. 3 Abs. 1 HUntStProt 2007), hat aber auf das autonome IPR übergegriffen. In Art. 19, 20 und 21 wird der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes seit 1.7.1998 zum primären Anknüpfungskriterium für das gesamte Kindschaftsverhältnis gemacht. Die Staatsangehörigkeit tritt hier nur noch als alternatives Anknüpfungskriterium auf (zur Begünstigung der Abstammungsfeststellung Art. 19 Abs. 1 S. 2).
274
Im europäischen IPR, das sich in Verordnungen nach Art. 81 AEUV fortentwickeln wird, dürfte der gewöhnliche Aufenthalt zum primären Anknüpfungskriterium des Personalstatuts werden,[46] auch wenn damit dem Ziel, eine den Betroffenen nahe Rechtsordnung anzuwenden, angesichts zunehmender Mobilität schwerlich erreicht wird.
275
b) Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts ist nicht aus einer gesetzlichen Definition entstanden, was seine Verwendung in völkervertraglichen Vereinbarungen begünstigt hat. In einer Resolution des Ministerrats des Europarates v. 18.1.1972 wird ein zweigliedriger Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts empfohlen, der sich von dem eingliedrigen Begriff des schlichten Aufenthalts abgrenzt und sich mit den insbesondere zum MSA in der Rechtsprechung entwickelten Kriterien deckt:
276
aa) Aufenthalt hat eine Person dort, wo sie sich tatsächlich aufhält. Auf eine Willensrichtung oder die Legalität des Aufenthalts kommt es nicht an. Schon die Wohnsitznahme für einen gewissen, vorübergehenden, nicht notwendig ununterbrochenen Zeitraum begründet den Aufenthalt.
277
bb) Ein gewöhnlicher Aufenthalt erfordert, dass der Aufenthalt auf Dauer angelegt ist, was nicht voraussetzt, dass der Aufenthalt schon länger angedauert haben muss. Dauerhaftigkeit kann sich auch zukunftsgerichtet aus den Umständen des Falles ergeben. Zweites Element ist, dass die Person dort ihren Daseinsmittelpunkt hat. Hierbei sind private und berufliche Umstände zu berücksichtigen, welche eine enge und dauerhafte Beziehung zwischen der Person und ihrem Aufenthalt anzeigen; es muss eine gewisse Integration in familiärer und beruflicher Hinsicht und der Schwerpunkt der Bindungen an diesem Ort[47] vorliegen. Der Wille der Person, den Aufenthalt beizubehalten, ist danach nicht Voraussetzung für den gewöhnlichen Aufenthalt, ist aber bei der Bestimmung, ob der Aufenthalt zum Daseinsmittelpunkt geworden ist, wesentlich zu berücksichtigen; eine zwangsweise Unterbringung begründet keinen gewöhnlichen Aufenthalt. Im Rahmen der Rom III-VO und der EU-ErbVO wird jedoch aus Gründen der Stabilisierung des Begriffs des gewöhnlichen Aufenthalts eine Abhängigkeit vom Willen diskutiert.
278
cc) Der gewöhnliche Aufenthalt von Minderjährigen hat die Rechtsprechung vor allem im Zusammenhang mit dem MSA vielfach beschäftigt. Da der gewöhnliche Aufenthalt auch bei Minderjährigen nicht als rechtliche Fiktion von dem der Sorgeberechtigten abgeleitet wird (anders § 11 BGB für den Wohnsitz), sondern nach den für den Minderjährigen geltenden tatsächlichen Gegebenheiten zu bestimmen ist, kann sich der gewöhnliche Aufenthalt des Minderjährigen selbst gegen den Willen eines (allein) Sorgeberechtigten ändern.
279
Die Prüfung einer sozialen und familiären Integration wird insbesondere in Fällen von Kindesentführung durch einen Elternteil oder Verwandten (sog legal kidnapping) bedeutsam. Verbringt ein Elternteil das Kind gegen den Willen des anderen (allein oder mit-) sorgeberechtigten Elternteils in ein anderes Land (oft sein Heimatland), so schließt der entgegenstehende Wille eines Sorgeberechtigten nicht die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts aus. Andererseits kann der gewöhnliche Aufenthalt am neuen schlichten Aufenthaltsort nicht sofort begründet werden, weil die Dauerhaftigkeit der Eingliederung, anders als etwa beim Umzug des Kindes mit beiden Eltern, wegen des entgegenstehenden Willens des Sorgeberechtigten nicht von vornherein feststeht.[48] Andererseits ist die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts gerade in solchen Fällen oft entscheidend, weil vom Bestehen des gewöhnlichen Aufenthalts die internationale Zuständigkeit aus Art. 5 KSÜ, Art. 1 MSA oder Art. 8 Brüssel IIa-VO abhängt (vgl aber Rn 281).
280
Die Integration eines Kindes hängt stark von seinem Alter ab; sie ist im frühkindlichen Stadium weitestgehend familienorientiert, weshalb es zwar nicht zu einer rechtlichen Ableitung vom Sorgeberechtigten kommt, aber zu einer faktischen Berücksichtigung des gewöhnlichen Aufenthalts des betreuenden Elternteils.[49] Später kommen soziale Außenbeziehungen (Kindergarten, Schule) hinzu.[50] In der Rechtsprechung wurde bisher in „Entführungsfällen“ sowie in Fällen einer sonst zwischen den Sorgeberechtigten strittigen Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts eine konkrete soziale Eingliederung angenommen, wenn der Minderjährige am neuen Aufenthaltsort seit mindestens sechs Monaten (als „Faustregel“)[51] normal integriert lebt, also etwa Schule oder Kindergarten besucht oder als Kleinkind im Familienverband mit einem Elternteil und/oder sonstigen Verwandten lebt, ohne dass der andere Elternteil konkrete Schritte zur Rückführung unternimmt. Selbst wenn der Aufenthalt des Kindes durch den allein Sorgeberechtigten verlegt wird, dürfte nicht sogleich die für den Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts erforderliche Integration eintreten; bei einem Kleinstkind, das bei der bisherigen engsten Bezugsperson bleibt, die in ihr Heimatland zurückkehrt, wo diese selbst stark integriert ist, wird jedoch sehr bald ein neuer gewöhnlicher Aufenthalt anzunehmen sein.[52]
281
Um den Übergang der Zuständigkeit zu verzögern, treffen Art. 7 Abs. 1 KSÜ und Art. 10 lit. b Brüssel IIa-VO in „Entführungsfällen“ Sonderregelungen zur Fortdauer der Zuständigkeit der Gerichte des Staates, aus dem das Kind entführt wurde. Obgleich diese Regelungen so formuliert sind, dass trotz Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts die Zuständigkeit fortbesteht, wirft die dort normierte Jahresfrist die Frage auf, in welchem Verhältnis die Jahresfrist zur „Faustregel“ eines mindestens 6-monatigen Aufenthalts steht.
282
dd) Einen wesentlichen Schritt zur Rückführung entführter Kinder hat das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung v. 25.10.1980[53] bewirkt (HKiEntÜ; Rn 983 ff). Zwischen den Mitgliedstaaten wird der Vorrang der Entscheidung der Gerichte des Staates, aus dem das Kind entführt wurde, durch Art. 11 Brüssel IIa-VO gegenüber dem HKiEntÜ verstärkt. Weitere Änderungen sind in Art. 22 ff des Vorschlags einer Brüssel IIb-VO geplant.[54]
283
c) Vom Wohnsitz nach deutschem Recht unterscheidet sich der gewöhnliche Aufenthalt in drei Kriterien: Der Wohnsitz wird im Regelfall willentlich begründet (§ 7 Abs. 1 BGB: „niederlässt“; deutlich § 8 Abs. 1 BGB) und aufgehoben (anders aber § 9 BGB). Der Wohnsitz von Minderjährigen wird von dem der Eltern abgeleitet (§ 11 BGB). Ein Wohnsitz kann an mehreren Orten bestehen. Der gewöhnliche Aufenthalt ist hingegen nicht willensabhängig, wird unabhängig von der Geschäftsfähigkeit nach den Lebensumständen der betroffenen Person bestimmt und kann nicht mehrfach sein. Gemeinsam haben beide Konzepte, dass sie einen (faktischen bzw gewillkürten) Daseinsmittelpunkt erfordern,[55] weshalb eine Person ohne Daseinsmittelpunkt weder einen gewöhnlichen Aufenthalt noch einen Wohnsitz hat.
284
d) Vom domicile des Common Law Rechtskreises, das dort die Staatsangehörigkeit als das primäre Anknüpfungskriterium für das Personalstatut ersetzt, ist der gewöhnliche Aufenthalt ebenfalls zu unterscheiden.
285
Die Bedeutung des domicile in den Common Law Staaten als räumliches Anknüpfungskriterium anstelle der auf dem europäischen Kontinent bevorzugten Staatsangehörigkeit erstreckt sich auf personen-, familien- und erbrechtliche Beziehungen. Dabei sind jeweils Rechte an unbeweglichen Sachen ausgenommen; sie werden dem Belegenheitsrecht unterstellt. Historisch geht dies zurück auf Joseph Story, der – wie übrigens auch noch v. Savigny (der an das Domizil anknüpfte, Rn 34) – den Schwerpunkt solcher Rechtsverhältnisse vorzugsweise räumlich bestimmte. Der rechtspolitische Grund für die Bevorzung des domicile als Anknüpfungskriterium besteht wohl darin, dass England als Seefahrernation sich kollisionsrechtlich mit dem Faktum der Auswanderung und Niederlassung von Staatsangehörigen in fremden Ländern zu befassen hatte. Noch stärker sind in den USA, in Kanada und in Australien die Argumente für eine räumliche statt einer staatsangehörigkeitsbezogenen Anknüpfung: Als Einwanderungsstaaten war diesen Ländern zunächst an schneller Integration großer Zahlen von Zuwanderern gelegen; die Gerichte sollten nicht mit der Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts belastet werden, eine sofortige Einbürgerung kam naturgemäß aber nicht in Betracht. Zudem handelt es sich um Mehrrechtsstaaten; Staatsangehörigkeit aber ist ein ungeeignetes Kriterium, wenn zwischen den Familienrechtsordnungen mehrerer Bundesstaaten (eines Gesamtstaates) zu entscheiden ist.
286
Der Begriff des „domicile“[56] wird nicht in allen Staaten des Common Law-Rechtskreises vollständig gleich verstanden. Gemeinsam sind jedoch die folgenden Grundsätze: Jeder Mensch hat ein und nur ein domicile, das nicht an einem Ort, sondern in einem Gebiet einheitlicher Jurisdiktion (England, Florida, New South Wales, Ontario etc) besteht. Das erste domicile, sein domicile of origin, erwirbt ein Mensch durch Geburt als abgleitetes domicile von den Eltern (früher Vater). Ein Wechsel des domicile – hin zu einem domicile of choice – setzt zwei Kriterien voraus: Persönliche Anwesenheit (physical presence) und das Willenselement (mental attitude), dort für unbestimmte Zeit (for indefinite future time) zu bleiben.
287
Der bekannteste Unterschied zwischen dem englischen und dem US-amerikanischen domicile-Begriff besteht in der sog revival doctrine, der das englische Recht im Gegensatz zum US-Recht folgt und die ein klassisches Produkt englischer Seefahrertradition ist: Verlässt eine Person ihr domicile (einerlei ob domicile of origin oder choice) mit dem Willen, es für immer (unbestimmte Zeit: intention to remain forever) aufzugeben, so verliert sie es. Vor Ankunft am Ziel kann dort kein neues domicile begründet werden, denn es fehlt an der physical presence. Treten während der Reise Rechtsfragen auf – zB löst der Tod des Reisenden den Erbfall aus – so kann er nicht ohne domicile sein. Um die (bei Seereisen bis tief in das 20. Jahrhundert oft beträchtliche Zeit andauernde) Lücke zu schließen, lässt die revival doctrine das domicile of origin wieder aufleben, auch wenn es schon Jahrzehnte lang durch Wahldomizile ersetzt war. Das US-Recht lässt hingegen das letzte domicile fortbestehen, bis ein neues begründet wird. Dieser flexibleren Sicht schließen sich andere Common Law-Staaten an und geben die revival doctrine auf.[57]
288
Das domicile unterscheidet sich vom gewöhnlichen Aufenthalt ebenfalls durch drei Kriterien: Ein domicile wird willensabhängig begründet; es wird für Minderjährige (früher auch für Ehefrauen) abgeleitet bestimmt und es erfordert eine noch stärkere Dauerhaftigkeit des Verbleibs; während beim gewöhnlichen Aufenthalt länger befristete Aufenthalte genügen, wird ein domicile of choice nur bei vorbehaltlos dauerhaftem Bleibewillen begründet, insbesondere, wenn die Aufgabe des domicile of origin in Rede steht.
289
e) Gewöhnlicher Aufenthalt, Wohnsitz und domicile lassen sich nicht linear vergleichen, sondern haben in den verschiedenen Kriterien teils Gemeinsamkeiten, teils graduelle oder diametrale Unterschiede, die jedoch durchaus sinnvoll sind: Die erforderliche Bindung an den jeweiligen Ort wächst vom Wohnsitz über den gewöhnlichen Aufenthalt zum domicile. Nur der (deutsche)[58] Wohnsitz kann (deshalb) sogar mehrfach sein. Ein Willenselement ist nur bei Wohnsitz und domicile erforderlich, wobei das Willenselement des Wohnsitzes weniger intensiv (niederlassen) als beim domicile (for an indefinite period) ist. Nur der gewöhnliche Aufenthalt kommt ohne die Figur der rechtlich abgeleiteten Bestimmung aus; rein tatsächliche, einen Willen nicht erfordernde Kriterien kann man auch bei Minderjährigen und Geschäftsunfähigen bestimmen, der nicht notwendig rechtsgeschäftliche Wille Erwachsener prägt deren Integration.
2. Parteiautonomie, Rechtswahl
290
a) Der Parteiwille als Anknüpfungskriterium bedeutet Zulassung der Wahl des anzuwendenden Rechts. Die Freiheit zur Rechtswahl (Parteiautonomie) ist zu unterscheiden von der Freiheit, innerhalb des anzuwendenden Rechts bestimmte Rechtsfolgen autonom herbeizuführen (Privatautonomie). Zwar wird häufig ein Rechtsgebiet, innerhalb dessen die Privatautonomie nur geringe Einschränkungen erfährt, auch der Parteiautonomie eher zugänglich sein als Gebiete mit überwiegend zwingenden materiellen Regelungen. Jedoch besteht kein Gleichklang der Interessen. Parteiautonomie wird in jeder Rechtsordnung durch einzelne zwingende Normen begrenzt. Wo das anwendbare Recht gewählt werden kann, besteht dagegen generell das Risiko, dass sogar diese zwingenden Normen einer Rechtsordnung umgangen werden, indem man die Rechtsordnung insgesamt abwählt. Parteiautonomie wird daher – soweit überhaupt zugelassen – im IPR mit zwei Methoden begrenzt: Entweder wird sie nur in bestimmten sachbezogenen Fällen zugelassen oder das IPR gewährt sie umfassend, setzt aber Bestimmungen, die den Ausschluss zwingender Normen eines „eigentlich“ sachnahen Rechts verhindern, indem sie solche Normen gegen das gewählte Recht durchsetzen.
291
So besteht etwa im materiellen Ehegüterrecht in zahlreichen Rechtsordnungen Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Güterrechtsmodellen; dennoch sehen nur sehr wenige Kollisionsrechte (zB § 19 österreichisches IPRG) eine vollständig freie Wahl des Ehegüterstatuts vor; Art. 15 Abs. 2 wählt die erste Methode der Einschränkung und erlaubt die Rechtswahl nur zugunsten bestimmter als sachnah angesehener Rechtsordnungen, wobei hier der Gedanke der Selbstintegration in einer Güterrechtsordnung prägend ist. Sehr eng sieht auch Art. 22 EU-ErbVO eine Rechtswahl des Erblassers nur zu einem Heimatrecht vor, was einerseits eine Korrektur der Aufenthaltsanknüpfung erlaubt, andererseits Gestaltungsmissbrauch (Noterben, Pflichtteilsberechtigte) verhindern soll. Soweit die Rechtswahl zulässig ist, bestimmt sich anschließend der Umfang der Privatautonomie ausschließlich nach dem gewählten Recht: Wählt ein Deutscher mit gewöhnlichem Aufenthalt in Texas sein Heimatrecht als Erbstatut, so unterstellt er sich damit auch der Beschränkung seiner Testierfreiheit durch das Pflichtteilsrecht.
292
b) Der klassische Anwendungsbereich der Parteiautonomie ist das Schuldvertragsrecht. In diesem Bereich ist Parteiautonomie das vorrangige Anknüpfungskriterium (Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom I-VO).
Im IPR der Schuldverträge ist Parteiautonomie die Regel. Die Rom I-VO setzt aber, wie schon das EVÜ, gegen eine Rechtswahl in bestimmten Fällen (Art. 3 Abs. 3, Art. 6 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 Rom I-VO) die zwingenden oder eine bestimmte schwächere Vertragspartei schützenden, die Privatautonomie begrenzenden unabdingbaren Bestimmungen des Rechts durch, das ohne Rechtswahl anwendbar wäre. Soweit deutsches Verbraucherschutzrecht auf Richtlinien beruht, die eine kollisionsrechtliche Absicherung vorsehen, erfolgt die Durchsetzung zusätzlich zu Art. 6 Abs. 2 Rom I-VO auch aufgrund Art. 46b. Darüber hinaus werden Eingriffsnormen (zwingende Vorschriften zum Schutz eines öffentlichen Interesses) nach Art. 9 Rom I-VO gegen ein gewähltes aber auch gegen gesetzlich angeknüpftes Schuldstatut durchgesetzt.
293
c) In anderen Rechtsgebieten ist die Parteiautonomie seit der IPR-Reform 1986 im Vordringen, tritt jedoch immer neben eine willensunabhängige objektive Grundsatzanknüpfung. Dann ist zu unterscheiden, ob die Rechtswahl nur in bestimmten Fällen erlaubt ist oder ob sie immer zulässig ist, ggf aber nur bestimmte Rechtsordnungen wählbar sind.
294
Ob eine Rechtsordnung Rechtswahl als Grundsatz oder als Ausnahme neben einer gesetzlichen Anknüpfung formuliert, offenbart allerdings mehr die rechtspolitische Zielsetzung und ist im Ergebnis meist einerlei; soweit Rechtswahl nämlich erlaubt wird, verdrängt sie notwendigerweise das nach objektiven Kriterien bestimmte Recht. ZB normiert das schweizerische IPR – weil es die Ehegatten zur Wahl auffordern will – die Wahl des Ehegüterstatuts als Grundsatz (Art. 52 Abs. 1 schweizIPRG), erlaubt aber dennoch nur die Wahl bestimmter Rechtsordnungen (Art. 52 Abs. 2 schweizIPRG). Art. 15 Abs. 1 normiert zwar das Ehegüterstatut grundsätzlich objektiv, Art. 15 Abs. 2 erlaubt aber die Rechtswahl umfassend und lässt sogar einen größeren Kreis von Rechtsordnungen zur Wahl zu als das schweizerische Recht. Dagegen erlaubt Art. 14 Abs. 2 und 3 eine Wahl des Ehewirkungsstatuts nur in bestimmten Konstellationen und begrenzt den Kreis der wählbaren Rechtsordnungen.
295
Rechtswahl ist im deutschen IPR zulässig im Namensrecht (Art. 10 Abs. 2 und 3; in bestimmten Konstellationen und nur bestimmte Rechtsordnungen wählbar), im Ehewirkungsrecht (Art. 14 Abs. 2 und 3; in bestimmten Konstellationen und nur bestimmte Rechtsordnungen wählbar), bis zum Inkrafttreten der Rom III-VO auch im Scheidungsstatut (Art. 17 Abs. 1 aF iVm Art. 14 Abs. 2, 3, zur Rom III-VO Rn 296), im Ehegüterrecht (Art. 15 Abs. 2; immer, jedoch nur bestimmte Rechtsordnungen wählbar) und bis zum Inkrafttreten der EU-ErbVO eng begrenzt im Erbrecht (Art. 25 Abs. 2 aF; nur deutsches Recht für inländische Immobilien wählbar).
296
Die EU-rechtlichen Kollisionsnormen im Familien- und Erbkollisionsrecht setzen verstärkt, jedoch in deutlich unterschiedlichem Maß, auf Rechtswahl: Art. 5 Rom III-VO (VO EU Nr 2010/1259) erweitert die Wahlmöglichkeiten des Scheidungsstatuts deutlich gegenüber Art. 17 aF, Art. 22 EU-ErbVO (VO EU 2012/650) erlaubt für das Erbstatut nur die Heimatrechtswahl und damit eine Rückoption zum Staatsangehörigkeitsprinzip, Art. 22 der noch nicht anzuwendenden EU-EheGüterVO (VO EU 2016/1103) und EU-ELPGüterVO (VO EU 2016/1104) sind in der Bandbreite wählbarer Rechte Art. 15 Abs. 2 EGBGB ähnlich. Wahlfreiheit wird ausdrücklich als Kompensation der durch den Übergang zum Aufenthaltsprinzip (dazu Rn 274) verursachten Vorhersehbarkeitsrisiken verstanden. Wenig bedacht wird hierbei, dass Rechtswahl im IPR nur dann ihrer Funktion gerecht wird, wenn ein Bewusstsein der Wahlmöglichkeit in beteiligten Verkehrskreisen besteht; dieses Bewusstsein kann in Fragen des Personalstatuts nicht vorausgesetzt werden, so dass allenfalls juristisch beratene Beteiligte hieraus Nutzen ziehen. Ein Problembewusstsein Betroffener dürfte eher im Ehegüter- und Erbstatut als im Scheidungsstatut zu erwarten sein.
297
Im deutschen außervertraglichen Schuldrecht (dem auch neben der Rom II-VO ein sachlicher Anwendungsbereich verbleibt) wirkt sich die Rechtswahl mittelbar für die bereicherungsrechtliche Leistungskondiktion aus, weil diese an das Vertragsstatut anknüpft (Art. 38 Abs. 1). Das Deliktsstatut kann (nach der Tat – Art. 42 – aber auch vorher, zB für Delikte, die sich anlässlich einer Sonderbeziehung ereignen können – Art. 41 Abs. 2 Nr 1) gewählt werden.
298
Die sachlich weitgehend für das außervertragliche Schuldrecht ab dem 11.1.2009 als loi uniforme anwendbare Rom II-VO (VO EG Nr 864/2007) knüpft ebenfalls die Leistungskondiktion an das (ggf gewählte) Vertragsstatut an (Art. 10 Abs. 1 Rom II-VO). Dasselbe gilt für das Deliktsstatut, wenn das Delikt in enger Verbindung zu einem Vertrag steht (Art. 4 Abs. 3, Art. 5 Abs. 2 Rom II-VO). Überdies ist für alle außervertraglichen Schuldverhältnisse eine nachträgliche freie Rechtswahl und zwischen Unternehmern auch eine vorherige freie Rechtswahl vorgesehen (Art. 14 Abs. 1 Rom II-VO; zu Einschränkungen Abs. 2, 3, dazu Rn 1412 ff).
3. Sonstige Anknüpfungskriterien
299
a) Der schlichte Aufenthalt hat nur als äußerst hilfsweises Anknüpfungskriterium Bedeutung. Er bestimmt das Personalstatut für Staatenlose, die keinen gewöhnlichen Aufenthalt haben (Art. 5 Abs. 2). Der schlichte Aufenthalt eines Ausländers in Deutschland erlaubt die Bestellung eines Betreuers nach deutschem Recht (Art. 24 Abs. 1 S. 2). Es genügt für den schlichten Aufenthalt die tatsächliche Anwesenheit des Betroffenen; die Dauer oder Beständigkeit des Aufenthalts ist ohne Belang.
300
b) Der Ort einer Handlung ist noch immer ein verbreitetes Anknüpfungskriterium, auch wenn seine Bedeutung geringer ist als manchmal von Nichtkundigen vermutet.
301
Wegen der Manipulierbarkeit und Zufälligkeit ist die früher als objektive Anknüpfung bei Fehlen einer Rechtswahl vieldiskutierte und in anderen Rechtsordnungen noch bekannte Anknüpfung der materiellen Beurteilung von Verträgen an den Abschlussort einer Gesamtschau von Kriterien im Sinne der engsten Verbindung gewichen. Auch die materielle Beurteilung familienrechtlicher Verhältnisse unterliegt nicht dem Eheschließungsort (eine in Las Vegas geschlossene Ehe ist also nicht etwa in ihren Wirkungen vom Recht Nevadas beherrscht).
302
Für die Anknüpfung der Form von Rechtsgeschäften ist der Abschlussort gleichberechtigtes alternatives Anknüpfungsmerkmal neben dem Geschäftsstatut (Art. 11 Abs. 1). Für die Form der Eheschließung in Deutschland ist die Anknüpfung an den Ort sogar das einzige Anknüpfungskriterium (Art. 13 Abs. 3 S. 1). Für die Form von letztwilligen Verfügungen existieren dagegen neben dem Errichtungsort zahlreiche andere (alternative) Anknüpfungskriterien (Art. 1 Haager Testamentsformübereinkommen).



