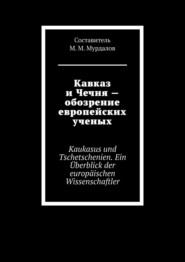скачать книгу бесплатно
Die Tschetschenzen geh?rten eine kurze Zeit lang politisch und religi?s mit den Lesghiern zusammen, unter der energischen und grausamen Herrschaft von Schamyl in dem von ihm gepredigten und gef?hrten Glaubenskampf gegen die Russen. Sie sind aber ein national getrenntes, selbst?ndiges Volk, ?ber dessen m?gliche Urverwandtschaft mit den Lesghiern oder andern V?lkern bisher nichts feststeht, und d?rfte n?heres Erforschen ihrer Sprache jetzt wohl den einzigen dazu f?hrenden Weg bieten.
Da sie keine Schriftsprache besitzen, wie alle sogenannten Bergv?lker des Kaukasus, so sind auch die nationalen Ueberlieferungen ?usserst unzuverl?ssig und schwankend. Es scheint aber, als ob die ?ltesten Stammsitze in ihrem mittleren Gebiet gelegen haben, d. h. wo weiterhin Thuschen wohnen, die in einer Gemeinde sprachverwandt sind, aber sonst als grusinischer Stamm gelten. Je weiter nach Osten und Westen hin, desto j?nger scheint die Besiedlung zu sein, wie die allerj?ngste am S?dufer des Terek erst in Folge der Kriege mit den Russen geschah, welche sie mehr unter Augen und in zug?nglicher Gegend, getrennt von ihren Hauptsitzen, wissen wollten.
Vielleicht sind sie verh?ltnissm?ssig sp?te Einwanderer, und ebenfalls wie andere im n?rdlichen sp?te Einwanderer, und ebenfalls wie andere im n?rdlichen Kaukasus auf Wanderungen vorbeigezogen oder abgedr?ngt worden; oder sie sind Reste von national geschiedenen Heerhaufen der Mongolen und Tataren des dreizehnten Jahrhundert, oder fr?herer, das s?dliche Russland beherrschender asiatischer V?lker.
Arabische Aufzeichnungen, die in diesen Gegenden von Chasaren, Osseten und selbst Gurdsh (Georgier) sprechen, erw?hnten nichts von den Tschetschenzen unter irgend einem Namen, was vielleicht f?r die eben ausgesprochene Annahme spricht, dass sie erst verh?ltnissm?ssig sp?t in ihre gegenw?rtigen Wohnsitze kamen, was ja zum Theil von ihnen selbst insofern angegeben wird, als sie sich gr?sstentheils als Ausz?gler aus eng begrenzten Stammsitzen im Gebirge ansehen.
Der Name Tschetschenzen, den sie selbst sich nicht geben, stammt von einer grossen Ortschaft ihres Gebiets, Tschetschen, die seit dem Feldzuge Peters des Grossen nach Persien bekannt ist und am untern Argun liegt; sie selbst nennen sich Nach-tschoi, wo «Nach» Volk bedeutet, aber auch B?r; im benachbarten Awarischen (Lesghischen) w?rde es Buttermensch bezeichnen, was wohl nur zuf?llig ist, da der Name Nach-tschoi bei ihnen selbst gebr?uchlich ist. – Die verschiedenen fr?her bei den Russen ?blichen Namen waren lokale und ?ber und ?bertragene Bezeichnungen, die dann verschwanden, als das ganze Volk unterworfen und bekannt wurde. Die Russen unterscheiden gegenw?rtig die Galgaier und Inguschen, aber die Tschetschenzen nennen sie beide mit dem gemeinsamen Namen Galgaier. Andere St?mme sind die Nasranower, Galaschewer, Karabulaken (die fr?her in der Schlucht Datyrchsk wohnten und gr?sstentheils nach der T?rkei zogen; die Zur?ckgeblieben zogen dann nach Ssaraptscha in der kleinen Tschetschnia am Flusse Pseduch und Tschetschen); aber alle heissen mit dem Gesammtnamen Nach-tschoi. Die, welche am Zusammenflusse des Mitchik Gums (Zufl?sse, von rechts der Bjelaja, die in die Ssunsha m?ndet), also schon ganz in der Ebene wohnen, wo viele tatarische Namen vorherrschen, nennen sich Mitschiko?er, woraus ein verst?mmelter Gesammtname Misdchеgi entstanden war. Die Itschkеrier werden von den Darginern (Lesghiern) Mitschi-chidsch, d. h. Bewohner von Gegenden, wo viel Hirse w?chst, genannt. Die Kumyken nennen die Tschetschenzen ebenfalls Mitschi-gysch; die Andier nennen die Tschetschenzen der n?rdlichen Ebene sind die sp?testen und unfreiwilligsten Uebersiedler.
Einige Ueberlieferungen der Itschkerier m?gen hier ihren Platz finden, da sie ein Streiflicht nicht allein auf die Abstammung, Verbreitung und Zusammensetzung des Volks der Tschetschenzen, sondern auch auf die Art der Besiedlung des ?stlichen Kaukasus ?berhaupt werfen, mit anderen Ueberlieferungen ?bereinstimmen oder ihnen nicht widersprechen und menschlich und geschichtlich verst?ndlich sind.
Tschingis-Chan, der Herrscher und Heerf?hrer der die ganze Mitte Asiens besiegenden Mongolen, gelangte, vornehmlich an der Spitze der Nogaier-St?mme, bei seinem Vorr?cken aus Westasien nach Kaukasus zuerst nach dem Daghestan, der bis vor wenigen Jahrhunderten noch, nicht sowohl den eigentlichen heutigen gebirgigen Daghestan, Lesghistan genannt, sondern den benachbarten K?stenstrich am kaspischen Meer umfasste. Von hier drang Tschingis-Chan wohl auf naturgem?ssem Wege nach der angrenzenden kumykischen Ebene n?rdlich davon vor, dann nach Itschkerien (Bergland am Akssai-Flusse, der sich nord?stlich in der Steppe verliert), dem Gebiet des westlich benachbarten Argun und der eigentlichen mehr n?rdlichen Tschetschna ein (Namen, die erst in viel sp?terer Zeit entstanden sind). Weiter vordringend befestigte er seine Macht hier durch die Anlage von Th?rmen, die meistentheils am Aus- oder Eingange von den hier allgemein und politischen Zweck hatten.
Die V?lker- und Heeres-Bewegungen Tschingis-Chan?s und seiner Nachfolger (wie schon zu den Zeiten Attila?s und wohl mehr oder weniger ?hnlich und h?ufig immer von Seiten asiatischer St?mme und Horden) l?sten in einem und demselben Gebiete die Bewohner ab, sie verdr?ngend oder sich mit ihnen mischend und wiederum Anderen Platz machend. So war es auch hier und unter ?hnlichen Bedingumgen. Anschauungen verschiedenster Art und Einfluss verschiedener Sprachen waren die unmittelbarsten damaligen Folgen solcher Wandlungen und Wanderungen. Etwa Anderthalb Jahrhunderte nach Tschingis-Chan trat ein ?hnlicher F?hrer und Herrscher auf, der, von uners?ttlichem Ehrgeiz und Eroberungstrieb geleitet, seine meist an der Wolga nomadisierenden V?lker so viel als m?glich durch Zuz?ge anderer, geworbener, zu verst?rken suchte, ehe er 1380 zu dem Riesenkampf mit den Russen auf dem Kulikower Felde im Quellgebiet des Don schritt, der dem siegreichen Grossf?rsten Demetrius (Dimitri) den Beinamen des Donischen (Donskoi) eintrug. Mamai hatte lange Zeit seine Residenz ?stlich von Stawropol an der Kuma unweit des Ortes Burgon-Madjari, wo er die F?rsten der unterworfenen oder Nachsicht erflehenden V?lker stolz empfing und Tribut und Geschenke entgegennahm. Hier wurde Michael, F?rst von Twer, zu Tode gemartert, weil er sich vor Mamai nicht erniedrigen wollte; in Erinnerung hieran wurde sp?ter hier ein Kloster errichtet. Von alten Fundamenten aus Ziegeln und selbst vom M?nzhof von Mamai werden noch Reste gezeigt. Ob der Name der Ortschaft Madjari eine historische Bedeutung hat oder ein tatarisches Wort ist, muss dahingestellt bleiben. Der Zusatz Burgon kommt daher, dass zu Zeiten Katharina?s II hier ein reicher Gutsbesitzer polnischer Nationalit?t sass, der ausgezeichnete Burgunder-Trauben zog und den Wein in Petersburg der Kaiserin vorsetzte.
Die in den Haufen Mamai?s k?mpfenden Hilfsv?lker aus Polowzen, charischen T?rken, Tscherkessen, Jassen (Ossen, Osseten, Asen), Juden (am Kuban wohnend, vielleicht Chasaren, die j?discher Religion waren), Armeniern und krimschen Genuesen bestehend und unter seiner Herrschaft zu einem gemeinschaftlichen Zweck ein ?usserlich Ganzes bildeten, das aber des nationalen und moralischen Bandes entbehrte, da nur egoistische oder aufgedrungene Interessen es belebte, fielen von selbst nach der Niederlage Mamai?s grossentheils auseinander und zogen, des Kampfes m?de, geschw?cht und gedr?ngt nach verschiedenen Richtungen in gr?sseren oder geringeren Gemeinschaften und Haufen fort, in sichere oder ferne Gegenden.
In Itschkerien waren die Tr?mmer der von Tschingis-Chan fr?her besiegten Einwohner, deren Grabst?tten bei Gersel-A-ul (Chassaw-Jurt, Jachssai-Jurt) und Major-tug (westlich davon und Major-Lager bedeutend) liegen und von denen ein Theil am Argun und im Daghestan in wenig wirthlichen Gebieten lebte, leicht von Mamai unterworfen und beherrscht worden, so dass der herrschende Stamm der Nogaier es vorzog, aus alter Gewohnheit nach der Steppe und Ebene zu ziehen, die gegenw?rtig die kumykische genannt wird. F?r diese Kumyken gewann das von ihnen verlassene, nun Itschkerien genannte Gebiet die Bedeutung von Itschi-Geri (Itschkerien), d. h. der Mitte einer von Erhebungen eingeschlossenen Ebene, oder der Mitte eines fr?her m?chtigen und herabgekommenen, armen, schwachen Volkes; daher auch der Name. Mamai hatte als Statthalter hier den Beg Jachssai zur?ckgelassen, der dem Volke die nationalen Sitten und Einrichtungen liess; in Folge dessen nannte dasselbe aus Dankbarkeit den Hauptfluss des Gebietes Jachssai-Ssu (Jachssai-Fluss), woraus Akssai entstand. Andere Haufen Mamai?s, des Krieges m?de, zogen nach noch mehr abgelegen und von der Natur gesch?tzten Gegenden weiter in?s Gebirge; so die Andier (Lesghier) als armenischer die Zudacharer (Lesghier) als grusinischer u. s. w.
In verh?ltnissm?ssig sp?ter Zeit wurden alle diese und andere St?mme zum Muhamedanismus bekehrt, der hier dauernd Wurzeln fasste, zumal die christliche Religion nur ganz ?usserlich und daher nie tief gehend gewirkt hatte.
Nach ?bereinstimmenden Ueberlieferungen scheint festzustehen, dass die Gegend am Argun, die Mitte des Gebiets der Tschetschenzen (jetzt ziemlich nach Westen verschoben), und Naschachе (am oberen Tschanty-Argun) deuten, zumal nat?rlicher Weise die besten, waldlosen Stellen besetzten, in denen sie erst sp?ter durch Vermehrung und Zuz?ge eingeengt und bedr?ngt wurden.
Solches musste zu Reibungen und Feindseligkeiten f?hren, zu diesen kamen noch fremd gewordene Begriffe, Gewohnheiten und religi?se Anschauungen, die im Verein mit der wilden Natur und ihren n?tzlich und sch?dlich wirkenden, vielfach unerkl?rlichen Erscheinungen Aberglauben und allerhand Vorstellungen erzeugten, so dass je das Individuum oder die Familie, seltener eine gr?ssere Gemeinschaft an besondere Naturkr?fte glaubte und sich eigene G?tter oder richtiger G?tzen schuf. Ohne Schriftsprache, ohne Lehrer und ohne Gliederung und Ordnung verwilderten und verkamen die Itschkerier, die von Hause aus wohl theilweise verschiedener Nationalt?t waren. So wurden Ehen mit Christen und Juden und anderen geschlossen und aus Mangel an Weibern solche von den Nachbarn oder Feinden geraubt, wovon die Spuren sich noch bis heute erhalten haben. Die aus solchen Mischehen Gebornen nahmen unwillk?rlich verschiedene Anschauungen und Gebr?uche der verschiedenen Eltern an. Auch auf die Sprache musste solches einwirken; daher finden wir im Tschetschenischen grusinische, kumykische und russische W?rter und Bezeichnungen von Lokalit?ten. Solche Zust?nde m?gen einige Jahrhunderte fortgedauert haben, so dass infolge dessen hier ein Volk lebte, welches die Itschkerier als ein solches nennen, das gar keine Gesetze besass: «Zaa-din-bozuschnach». Wenn auch Gegend und Lebensverh?ltnisse manche Uebereinstimmung hervorriefen, so liessen doch Egoismus, Rechtlosigkeit, Raub, Diebstahl und Rache nichts gedeihen und f?hrten schliesslich zu der Ueberzeugung, etwas Festes, Allgemeines herstellen zu m?ssen, zu welchem Zweck die verschiedenen gr?sseren Familien oder Geschlechtskreise beschlossen, auf dem Berge Kettech-Kort zusammenzukommen zu gemeinsamer Berathung und Feststellung eines Sittengesetzes, «Adat» genannt, dem sich das ganze Volk unterwarf, nur geringe Ausnahmen, auf lokale Verh?ltnisse begr?ndet, zulassend.
Der Name des Berges Kettesch-Kort, nahe dem Aul Zontari, zwischen dem Akssai und dem Mittellauf der oberen Bjelaja, ?stlich von Wedеn, bedeutet auf tschetschenisch w?rtlich («Kette – er kam hin, er verstand, er begegnete», – und Kort – Kopf, erh?hter Ort; also Kettesch-Kort) Berg der Begegnung; er wird bei den Tschetschenzen heilig gehalten, sowohl seines historischen Alters, als auch des hohen Zwecks wegen, dem er diente. Der Kurgan (Grabh?gel) auf hoher Erhebung wurde durch Menschenh?nde zusammengetragen, wie die Ueberlieferung lautet. Der Ort, als das Centrum Itschkeriens, diente ferner stets als Sammelplatz f?r die Alten der Itschkerier, deren Existenz immer mehr und mehr allgemein feststehender, auf Gebr?uchen und Gewohnheiten beruhender socialer und Beziehungen und Vorschriften bedurfte, Adat genannt.
Auf dem Berge Kettesch-Kort wurden nicht allein alle Streitigkeiten und Zwistigkeiten geschlichtet, deren Entscheidung durch die «Alten» man sich unbedingt unterwarf, sondern hier wurden auch Ab?nderungen des Adat getroffen, wenn sie sich als nothwendig erwiesen, besonders in Folge fortschreitender Entwicklung. Sobald es sich zeigte, dass Streitfragen vorkamen, die man nicht vorhergesehen hatte, begaben sich die «Alten» nach dem Ursitz oder der Urheimat Naschachе, um von dort die Entscheidung zu holen; da nach der Meinung der Itschkerier und Tschetschenzen im engern Sinn dort die reinsten und richtigsten Gewohnheiten und Gebr?uche herrschen, so dass noch unl?ngst ein mit der Entscheidung unzufriedener Itschkerier sich dorthin f?r endg?ltige Entscheidung wandte.
Ohne Zweifel waren die j?ngern, sp?tern Ausz?gler aus Naschachе die Hauptursache und Haupturheber der Feststellung des Adat, da sie aus gebildeteren und fester stehenden Verh?ltnissen und ?ltester Niederlassung in wilde und w?ste neue kamen. In Naschachе soll eine auffallende Gemeinschaft der Bewohner bestanden haben (etwa an Kasakenthum und ?berhaupt den Russen noch heute eigenen Associations-Geist und Trieb erinnernd, der vielleicht tatarischen Ursprungs, wie so Vieles bei ihnen ist); diese Gemeinschaft gab sich unter Anderem auch darin kund, dass die Bewohner von Naschachе aus einem grossen, gemeinsamen Kessel (wohl aus mehreren, aber gemeinschaftlichen) speisten, der als Symbol der Freundschaft und Br?derlichkeit der Einwohner galt, die sich gleichem Geschick zu unterwerfen gesonnen sind.
Das Sprachgebiet des Tschetschenischen hat seine kompakteste Verbreitung auf dem rechten Ssunsha-Ufer l?ngs deren Zufl?ssen, nur wird am oberen Tschanti-Argun grusinisch gesprochen. Die zweite grosse Sprachgruppe liegt n?rdlich getrennt am Terek. Nach Osten hin bilden der Jarykssu und Aktasch bis zu ihrem Austritt in die kumykische Ebene die Grenze; nach Westen die Kambilеjewka (Nebenfluss des Terek) und der Terek selbst in der Schlucht von Dsherachow. Am meisten verbreitet unter den Dialekten ist der der Ebene. Eine Eigenth?mlichkeit des Tschetschenischen (wie auch des Awarischen) besteht in dem Vorhandensein von mittleren oder scharf leidenden Zeitw?rtern; um eine ?bertragungst?tigkeit anzuzeigen, wird der handelnde Gegenstand aber, auf den die Th?tigkeit gerichtet ist, im Nominativ.
Der Dialekt der Itschkerier, obwohl verh?ltnissm?ssig alt, bildete sich in Folge der oben angef?hrten Umst?nde um, haupts?chlich wohl in Naschachе, dem Stammsitze, in dem sie friedlich und aus verschiedenartigen Elementen sich zusammenfanden. Dass dies der Fall war, best?tigt sich dadurch, dass nach der Ueberlieferung die ersten Bewohner der argunischen und itschkerischen Gebirge ein und dieselbe Sprache redeten und nach denselben Sitten und Gebr?uchen lebten, wie die im heutigen Bezirk von Argun, im n?rdlichen Itschkerien, in der Tschetschena und anderen Gegenden, die weniger dicht von Tschetschenzen bewohnt sind, da diese erst in der Folge sich durch Vermehrung ergiebt sich ?brigens, dass der Dialekt von Naschachе ganz derselbe mit dem der Galgaier ist, w?hrend diese letzteren sich darin etwas von den Schatoiern, Tschaberlo?ern und andern unterscheiden, die wiederum eine N?ance mit den Dialekten der eigentlichen Tschetschna und Itschkeriens aufweisen, was nicht ausschliesst, dass sich bei den letztern gewisse kleine Unterschiedene je nach Ortschaften, zeigen.
Die Dialekte der Naschachе und Galgaier stehen dem des gegenw?rtigen Bezirks von Argun n?her, als denen der Itschkerier und der Bewohner der Tschetschna.
Nahe dem Aul Naschachе liegt, nach der Aussage der Tschetschenzen, der Aul Kereten oder Keretan-Akch, d. h. der Ort des Christen Akchai. Dieser Umstand weist darauf hin, dass das Christenthum hier aus dem benachbarten Grusien eindrang, das durch die heilige Nina zu Anfang des vierten Jahrhunderts christlich geworden war, und wo sich dasselbe ununterbrochen und fest gegen religi?s, politisch und national feindliche m?chtige Nachbarn: T?rken, Perser, Tataren und Bergv?lker erhielt. Nach Itschkerien brachten das Christenthum einzelne Pers?nlichkeiten, die mehr wohl aus Unabh?ngigkeitstrieb, als Apostel kamen; da aber in den Felsschluchten sich verschiedene Glaubensanschauungen zusammenfanden, so gewann der Bestand des Christenthums nur geringe Festigkeit, zumal keine Autorit?t oder feste Lehre es aufrecht erhielt. Ein solcher Zustand dauerte bis zum Jahr 722, also etwa 400 Jahre, wo die Araber mit Feuer und Schwert den Muhamedanismus einf?hrten und das rohe und vielfach verschiedene Heidenthum verdr?ngten.
Nahe dem Aul Belgata, unweit von Dargo, ?stlich von Wedеn, liegen zwei hohe Kurgane, die als religi?ses Heiligthum und Wallfahrtsort dienten. Beide Kurgane haben bis heute ihre Namen erhalten; Stella und Jerda.
In sp?terer Zeit scheint das Christenthum in viele Gegenden und auf mancherlei Arten in verschiedenen Zeiten eingedrungen zu sein, worauf mannigfache Anzeichen hinweisen, so auch der Kreuzes-Schmuck an verschiedenen alten Bauten und einiges Andere. Als ein Beweis daf?r, wie ?berhaupt f?r grusinischen Einfluss, d?rfte auch dienen, dass ganz zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts (1603), als Grusien um Beistand bei dem Zaren von Moskau Gunоff (als Glaubensbruder) bat, dieser einen Abgesandten nach Grusien schickte, um an Ort und Stelle sich ?ber das Verlangte zu orientiren. Ihm kam in der Tschetschna der Thronerbe Grusiens entgegen, um ihn an der Grenze seines Gebiets und seiner Glaubensgenossen zu empfangen, wie dies so oft und besonders im Orient ?blich ist, und es l?sst sich ebenso wenig voraussetzen als erkl?ren, dass es geschehen w?re, wenn die Tschetschna nicht christlich und nicht unterworfen gewesen w?re.
Damit stimmt auch ?berein, dass viele Wohnsitze in dem Tschetschenzengebiet grusinische Namen haben, und nach der Ueberlieferung die Gebirgsgegenden ?berhaupt meist den Grusiern unterworfen waren.
Die Tschetschenzen haben eine besondere Sympathie f?r die Kabardiner, die sie «delikate» Leute nennen, und von denen sie vielfach Sitten und Moden annehmen; namentlich das Sattelzeug, die Nogaika (kurze Pferdepeitsche), die Burka, die mit Silber besetzten Riemen, was Alles bei den Kabardinern besser hergestellt wird. Sie nennen die Lesghier, ihre Nachbarn im S?den, Ssоli; die Kumyken aber Gumyken. Ihre Erz?hlungen, Sagen, Ueberlieferungen tragen alle den Charakter, dass alle jungen M?nner Helden sein m?ssen. Die Weiber verrichten alle Arbeiten im Hause und auf dem Felde, ausser dem M?hen des Heues; auch holen sie kein Holz aus dem Walde Walde und ackern nicht; das Korn schneiden sie mit einer gew?hnlichen Sichel. – Wenn kein Mann im Hause ist, so bitten sie zur Feldarbeit um fremden Beistand, der ihnen ohne Entsch?digung gew?hrt wird. Die Gastfreundschaft ist sehr entwickelt, so dass bei Armuth alles Nothwendige von den Nachbarn zusammengetragen wird, um den Gast zu bewirthen. Die Familien bleiben m?glichst beisammen; es erscheint ihnen ver?chtlich, sich abzutheilen, obwohl es jetzt ?fter vorkommt; der j?ngere Bruder darf nicht fr?her heirathen als der ?ltere. Der Wohlstand hat sich seit Beendigung des Krieges gegen die Russen (1859) wesentlich gehoben; man findet bessere Wohnh?user, Kleider, Einrichtung und Nahrung. Der russische Ssamowаr (Theekessel mit Kohle geheizt) kommt h?ufig vor, zur Bereitung des Thees, sowle von Kartoffeln, Gurken und Wassermelonen. Das Brod wird meist aus Mais gebacken, die flachen ossetischen und lesghischen Brode aber nur aus Weizenmehl.
Die Tschetschenzen sind im Ganzen sch?nere Gestalten als die Lesghier und Osseten und auch ein demokratisches Volk, das keine St?nde kennt und darin wesentlich von den Tscherkessen, die ?berhaupt edler von Natur und Sitten sind, unterschieden. Sehr auffallend ist der so vielfach verbreitete j?dische Typus, der in Itschkerien und Auch besonders stark und fast allgemein hervortritt, w?hrend der spezifisch arabische nur selten, aber stets auffallend edel vorkommt. Aus den kurzen historischen Andeutungen und besonders aus der Verbreitung des j?dischen Glaubens unter den Chasaren, der wohl durch zahlreiche Juden eingef?hrt und erhalten wurde, l?sst sich diese auch im Daghestan und sonst im Kaukasus auffallende Erscheinung theilweise erkl?ren. Eigenth?mlich tritt es hervor, dass besonders gebildete Tschetschenzen und h?here Befehlshaber noch aus der Zeit von Schamyl mit am meisten den j?dischen Typus zeigen, sich selbst aber als aus Scham (Damaskus) herstammend ausgeben, um ihre (vornehme) arabische Abstammung aus der Zeit der Einf?hrung der Lehre Muhamed?s zu beweisen, die bis um?s Jahr 1840 unter den Tschetschenzen nur sehr lauen Anhang gefunden hatte.
Aber auch in der Art zu sprechen, d. h. die Worte zu ziehen, erinnern die Tschetschenzen an Juden. Der Tschetschenze ist im Ganzen besser und geschmackvoller gekleidet als der Lesghier, dem er im Charakter, da er schlauer und listiger ist, nachsteht, obwohl solche Gesammturtheile schwer zu f?llen und auszusprechen sind. Die Weiber sind h?bscher und weniger bedr?ckt, als bei den Lesghiern, dergestalt, dass bei dem Besuch im Aul und dem ostensiblen Empfang von Seiten der Bewohner an der Flanke der M?nner einige zu dem Hause geh?rige Weiber standen, in welchem der Besuch erwartet wurde.
Sch?n und malerisch durch landschaftlich ansprechende Gebirgs- und Bergbildungen, von Fl?ssen durchstr?mt und von zusammenh?ngenden und einzelnen Baumgruppen durchsetzt, mit fruchtbaren, h?ufig durch heftige Regeng?sse hinabgesp?lten Feldern bedeckt, sind die beiden ?stlichen Gebiete der Tschetschenzen, die der Auch?er und Itschkerier, auch traditionell-militarisch f?r die kaukasischen Kriege die reichste und interessanteste Gegend; diese wird nach Osten hin deutlich durch einen Gebirgsr?cken begrenzt, der rippenartig von dem hohen und steilen Kamm nach Norden ausl?uft, der den Daghestan von dem Lande der Tschetschenzen trennt; dieser Gebirgsr?cken heisst Sala- (Ssala) Tau, d. h. vornehmes Gebirge. Auf dem kurzen Ostabfall dieser Gebirgsrippe zum Sulak (Ssulak) wohnen bereits Lesghier, die aber, als Tawliner oder Tawlinzen (Bergbewohner), einen etwas gemischten Typus aufweisen. Infolge der Richtung der Flussl?ufe nach Norden, wohin auch die kommerziellen Verbindungen nach der n?rdlichen Ebene und der grossen von West nach Ost, von Wladikawkas nach dem Hafen von Petrowsk und der Hauptstadt des Daghestan, Temir-Chan-Schurа, gehenden Strasse f?hren, ist das Eindringen nach Itschkerin und dem Lande Auch besonders leicht und belohnend, wenn man ihren vielfach gewundenen Th?lern aufw?rts folgend aus der Steppe durch das Gel?nde zu Berg- und Gebirgslandschaft aufsteigt; und hierbei machen die Erhebungen als Wasserscheiden zwischen den Fl?ssen meist keine besonderen Schwierigkeiten, wenn auch nat?rlich von Fahrwegen im europ?ischen Sinne des Wortes abgesehen werden muss, obwohl die zweir?drige Arba verm?ge der Einfachheit ihrer Construktion viel leichter als vierr?drige Fuhrwerke durchkommt. – Wesentlich wird Itschkerien durch eine grosse und durch Natursch?nheiten herrliche Strasse begrenzt, welche aus dem westlichen und Central-Daghestan ?ber das Gebirge nahe bei Andi in das Thal des Chorotschoi f?hrt, der im Unterlauf Bjelaja heisst und in die Ssunsha fliesst. Diese Strasse f?hrt weiterhin nach Grozny, einem Verwaltungscentrum und fr?heren wichtigen Militairposten; an ihr liegt in beinahe 1000 Meter H?he Wedеn (Wedenо), die letzte Residenz Schamyl?s, in einem l?nglichen, von waldigen H?hen romantisch eingefassten Thale. Wer nicht grossartige Natursch?nheiten, aber sch?ne, ansprechende und durch Berge, Gew?sser und Wald interessante und wechselvolle Landschaftsbilder sucht, der wird auf Ritten durch diese Gegenden reich belohnt. Selten schroff ist in Natur und Erhebung der pl?tzliche, ganz unvermittelte Gegensatz zwischen dem grauen, rauhen und todten Felslande des Daghestan und dem gr?nen, milden und lebensvollen Itschkerien; beide sind nur durch einen hohen Scharfen Gebirgswall getrennt, zu dem Itschkerien und Auch das davorliegende bewachsene Glacis bilden.
Die oben erw?hnte, s?dlich vom Terek von West nach Ost f?hrende Strasse l?uft in der Ebene unmittelbar l?ngs des Fusses dieses Glacis, und wenn der Terek den Vorgraben darstellt, so war er zugleich die erste russische Hauptangriffslinie und Parallele, l?ngs welcher die Linienkasaken angesiedelt wurden, welche die Tschetschenzen von Norden und Westen her, von der Ssunsha, einengten. Die n?chste Angriffsparallele gegen sie lag dann s?dlicher, am Fusse des eben erw?hnten Glacis, an dem Austritt der Fl?sse aus dem Berggebiet, bezeichnet durch die heute noch vorzugsweise, ja theilweise ausschliesslich eine militarisch-polizeiliche Bedeutung hebenden Ortschaften, Stabsquartiere genannt, da Regimentsst?be hier lagen und liegen: Tschir-Jurt, Chassaw-Jurt, Gersel-Aul und westlicher am Argun Wosdwischenskaja.
Wedеn und fr?her Dargo, nahe ?stlich davon, wie auch fr?her schon Achulgo, waren die zeitweisen Residenzen Schamyl?s, und wurden deshalb zu spezifischen Angriffsobjekten f?r russische Kriegsoperationen gew?hlt, deren Unhaltbarkeit im Prinzip und daher nicht entsprechende Ausf?hrung, bei der die aufgewendeten Mittel und Opfer in gar keinem Verh?ltnisse zu dem zu theuer erkauften Erfolge standen, mehrfach deutlich zu Tage trat. Jede Uebertragung von Begriffen, die ihren Ursprung der Kombination, der Reflektion verdanken, darf nur statt haben und kann nur erfolgreich sein, wenn die Grundbedingungen, die zu ihnen f?hrten, dieselben oder sehr ?hnliche sind. Wenn in Europa die Eroberung und Besitznahme der Hauptstadt eines feindlichen Landes meist den entscheidensten Wendepunkt des Krieges bezeichnet und als Hauptziel in?s Auge gefasst werden muss, so konnte solches, ganz abgesehen von der Kleinheit der Verh?ltnisse nach Lokalot?t und Macht, hier im Daghestan und der Tschetschna w?hrend der Kriege gegen Schamyl durchaus keine Stelle finden, obwohl man wiederholt glaubte, dass mit dem Falle seiner Residenzen gar keine politische oder strategische Bedeutung hatten. Ob Schamyl mit seinen in tiefster Armuth lebenden St?mmen zeitweilig oder dauernd hier oder dort seinen Wohnsitz aufschlug, von dem aus er herrschte und die Operationen leitete, war vollst?ndig gleichg?ltig. Eine Ortschaft, ein Felsennest war wie das andere und hatte spezifisch gar kleine besondere Bedeutung; sie war nur der zeitweilige Lagerplatz, die Lagerst?tte f?r Schamyl, der mit seinen M?riden (von ihm gew?hlten, zuverl?ssigsten, ergebensten, energischsten und gewandtesten jungen M?nnern) ?ber Alles und wachte, denen er zugleich religi?ses Oberhaupt war. – Die Orte selbst boten dazu nichts und konnten nichts dazu bieten, sie hatten gar keinen Vorzug noch Bedeutung vor andern voraus und wurden nur je nach den gerade herrschenden Umst?nden gew?hlt. Anders war es mit der letzten Residenz Schamyl?s, Wedеn; hier aber lagen die fr?heren Residenzen glaubte man mit dem Fall derselben Schamyl?s Herrschaft zu st?rzen, vergass aber, dass nicht der Ort seine Herrschaft begr?ndete, sondern dass dies nur seine Person war und es auf diese allein ankam, ganz gleichg?ltig, wo sie sich aufhielt und von wo sie wirkte. Nachdem der Statthalter des Kaukasus, F?rst Bar?tinski, eine durch Menschenkenntniss, europ?ise Bildung und Kultur, durch Geburt und Erziehung, Pers?nlichkeit und Charakter, selten vornehme und ?chte Soldatennatur, in richtiger Erkenntniss der Sachlage durch Erfahrung und Kampf Schamyl?s Fall wenige Jahre zuvor schon berechnend vorausgesehen hatte, schloss er ihn in dem ihm untergebenen Gebiete immer mehr ein und liess ihm nur Wedеn als letzte Residenz, da Schamyl, obwohl selbst ein Daghestaner, und vom Daghestan ausgehend in Gewalt und Operationen, doch der Tschetschna haupts?chlich bedurfte, sowohl deren militairischer wie strategischer H?lfe, als auch ihrer materiellen Mittel wegen, die der arme Daghestan nicht dauernd liefern konnte. So fiel auch mit der letzten Veste in der Tschetschna, Weden, pl?tzlich und vollst?ndig seine ganze Macht und sein ganzer Einfluss.
Es handelte sich also bei Weden nicht um Schamyl?s Residenz, sondern um Schamyl selbst und in erster Linie um sein letztes Gebiet und seine Macht bei den Tschetschenzen. Wenn einige Monate sp?ter sich Schamyl im Daghestan dem F?rsten Bar?tinski ergab, bereits als machtloser Fl?chtling, so war sein Fall und das Ende des Krieges im ?stlichen Kaukasus doch mit der Einnahme von Weden besiegelt gewesen.
Weden in beinahe 1000 Meter Meeresh?he ist, wie die meisten tschetschenischen Ortschaften, von denen es sich gegenw?rtig durch militairische und administrative Baulichkeiten wesentlich unterscheidet, eine von Fruchtg?rten und sonstigen B?umen umgebene und besetzte Ortschaft, wie ?berhaupt die tschetschenischen D?rfer etwas Freundliches, Ansprechendes haben, besonders im Gegensatz zu den Felsennestern und Steinbauten, oder richtiger Kasten, des Daghestan. Die H?user sind mehr aus Lehm und Holz erbaut, nur haben die meisten noch die flachen ?cht-orientalischen D?cher, die ausserordentlich n?tzlich gegen Feuersgefahr sind, sonst aber, besonders bei anhaltendem Regen, manches zu w?nschen ?brig lassen.
In der Umgegend von Weden wurden Knochenreste eines vorweltlichen Thieres gefunden, die sich bei n?herer wissenschaftlicher Untersuchung in Petersburg und Berlin als Thiele von den Kiefern eines Fisches erwiesen, der zur Gattung der Wale geh?rt und etwa die L?nge von mehr als drei Meter haben musste.
W?hernd des letzten Krieges der Russen in der T?rkei und Kleinasien hatten sich die Tschetschenzen, besonders aber die Lesghier, emp?rt und einen Aufstand gemacht, der nat?rlich keinen dauernden Erfolg oder politische Bedeutung gewinnen, immerhin aber viel lokales und pers?nliches Unheil anrichten konnte; der Aufstand wurde ohne besondere Folgen bald erstickt, hielt aber zwei russische Infanterie-Divisionen dauernd fest und verursachte manchen Schaden im Daghestan. Da es an einem einsichtsvollen und energischen F?hrer den Aufst?ndischen fehlte, so wurde er planlos und mit vollster Unkenntniss der Verh?ltnisse unternommen, obwohl Viele sich von ihm hinreissen liessen, die noch unter Schamyl gewisse Stellungen eingenommen hatten. – die Civilverwaltung hat in der Tschetschna seit einigen Jahren grosse Fortschritte gemacht, wenn auch das vielleicht etwas zu fr?h eingef?hrte Institut der Friedensrichter, das den Asiaten im Kaukasus ein ganz fremder Begriff ist, nicht verhindert hat, dass in der Tschetschna, selbst an der Poststrasse im Norden und bei den Inguschen, in unmittelbarer N?he von Wladikawkas, Raubanf?lle und Ueberf?lle vorkommen. Bei seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit und der bald das Land im Norden begleitenden Eisenbahn von Wladikawkas nach Petrowsk ist demselben bei gen?gender Besiedlung und entsprechender Administration eine sch?ne, bl?hende Zukunft mit Bestimmtheit vorherzusagen.
S?dlich von Grosny, das ein rechter Fieberort ist, den Argun aufw?rts ?ber Wosdwischenskaja hinaus, wie ?berhaupt auf der ganzen Ebene von Wladikawkas nach Petrowsk, liegen viele Kurgane, die hier sich vorzugsweise auf einer h?her gelegenen Stelle nahe dem Argun finden. In der Umgegend von Wosdwischenskaja giebt es deren ?ber hundert verschiedenster Gr?sse bis zu vielen Metern hoch, so dass auf ihnen theilweise Wachtposten etablirt sind.
Die Ausgrabungen einiger Kurgane ergaben nichts Besonderes, sie enthielten einige St?ck Eisen und Messer. Nach der Aussage der Tschetschenzen sollen sie von Kalmyken herstammen. Weiter aufw?rts nach Schatoi, wo sich Th?rme finden, l?uft ein schon in alter Zeit benutzter Weg ?ber das Gebirge nach Grusiern her zur Vertheidigung gegen Einf?lle von Norden.
«Die Tschetschenen»
Forschungen zur V?lkerkunde des nord?stlichen Kaukasus auf Grund von Reisen in den Jahren 1918—20 und 1927/28 von Doktor Bruno Plaetschke Assistent am Geographischen Institut der Universit?t K?nidsberg Pr. Mit 68 Figuren und einer Karte im Text und 24 Abbildungen auf 12 Tafeln. 1929. Druck von J. J. Augustin in Gl?ckstadt und Hamburg.
Vorwort
Von Oktober 1927 bis Februar 1928 durchwanderte ich das am Nordostabhang des Kaukasus gelegene Gebiet der Tschetschenen und Teile des nordwestlichen Daghestans kreuz und quer zu allgemein landes- und volkskundlichen Studien. Nicht ohne Absicht hatte ich mir gerade dieses Gebiet ausgew?hlt. Es kann n?mlich ohne Umschweife gesagt werden, da? das Tschetschenengebiet vom gesamten Kaukasus bisher das unbekannteste geblieben ist. Die Gr?nde hierf?r sind verschiedener Art. Zun?chst einmal finden wir im kaukasischen Osten nicht die machtvolle eisgepanzerte Hochgebirgswelt wie in der Westh?lfte des Gebirges, wenn auch die Berge des Daghestan z. B. des Eigenartigen genug bieten und auch der verw?hnteste Reisende dort auf seine Kosten kommen wird. Jedenfalls haben sich die europ?ischen und auch die russischen Touristen und Wissenschaftler in der Hauptsache meist nur durch die zentrale Gebirgskette zwischen Kasbek und Elbrus anziehen lassen, von einigen Ausnahmen abgesehen. Und diejenigen, die nach dem Osten gingen, wandten auch hier ihre Hauptaufmerksamkeit in der Regel nur dem Hochgebirge zu; das Mittelgebirge wurde viel weniger durchforscht. dieses nimmt aber gerade im Tschetschenengebiet den weitaus gr??ten Raum ein, sofern man darunter alle Berge versteht, die die Schneegrenze nicht mehr erreichen. Das einzige Hochgebirge, die Pirikitelische Kette, bildet schon die s?dliche Grenze des Gebietes, geh?rt also nur mit seinem Nordhang noch zum Tschetschenengebiet.
Ein weiterer Grund, der vielleicht manchen abgehalten hat, einmal die tschetschenischen Berge aufzusuchen, war wohl der h?chst ?ble Ruf, in dem die Tschetschenen im allgemeinen standen. Sie galten und gelten von allen Kaukasusv?lkern wenn auch nicht als das wildeste, – in diesem Punkt d?rften sie von den Chewsuren und den Swanen noch ?bertroffen werden – so doch als das unzuverl?ssigste und unruhigste. Raub?berf?lle, bei denen es auf ein Menschenleben nicht ankommt, kommen auch jetzt noch vor, ja man kann sagen, da? nach einiger Zeit der Ruhe das Bandenunwesen gerade jetzt wieder aufzuleben beginnt; selbst die streng durchgreifenden Sowjetbeh?rden sind dagegen machtlos. Ich selbst kann mich freilich ?ber Unfreundlichkeiten von seiten der Bev?lkerung nicht beklagen, sondern bin, von einem Sonderfall abgesehen, ?berall mit Freundlichkeit, ja Herzlichkeit aufgenommen worden. Das hatte freilich seinen besonderen Grund auch darin, da? ich von einem fr?heren Aufenthalt in den Revolutionsjahren 1918—20 viele Bekannte in den Bergen hatte, deren Unterst?tzung ich mich jetzt wieder erfreuen konnte.
Wenn ich auch bei diesem ersten Aufenthalt keine wissenschaftlichen Ziele verfolgte – ich war milit?risch auf Seiten der Bergv?lker t?tig —, so erwarb ich mir doch eine gute Kenntnis von Land und Leuten, so da? ich diesmal keine Zeit zu verlieren brauchte mit allgemeiner Orientierung.
Die vorliegende Arbeit bringt nur die volkskundlichen Beobachtungen und auch von diesen nur einen Teil. Wenn die Reise auch haupts?chlich zu allgemein landeskundlichen Studien unternommen wurde, so hatte ich doch gen?gend Gelegenheit, volkskundliche Beobachtungen zu machen, und das wiederum dank der engen F?hlung mit den Eingeborenen, insbesondere deswegen, weil ich Abend f?r Abend bei ihnen zum ?bernachten einkehrte. Und das ist letzten Endes Bedingung f?r erfolgreiches Arbeiten.
Meine volkskundlichen Beobachtungen wurde nicht systematisch gemacht und weisen daher manche Dinge erst zu achten anfing, als es schon zu sp?t war und mein Aufenthalt zu Ende ging. In der Hauptsache beschr?nkte ich mich auf Sammlung von Materialen, die die materielle Kultur betreffen. F?r genaueres Studium der geistigen Kultur, insbesondere auch der sehr interessanten gesellschaftlichen Zust?nde, reichte die Zeit nicht aus. Auch sind derartige Untersuchungen ohne Kenntnis der Stammessprache mit gro?en Schwierigkeiten verbunden. Meine russischen Sprachkenntnisse n?tzten mir in den entlegenen Gebirgsd?rfern nicht viel, da dort Russisch nur von sehr wenigen verstanden wird, in manchen D?rfern ?berhaupt von niemandem. Dasselbe gilt vom Tatarischen bzw. Kum?kischen, das im Daghestan vielfach als Umgangssprache dient; es ist nur den den Kum?ken unmittelbar benachbarten Tschetschenen bekannt.
Bei der Unbekanntheit des Gebietes habe ich es f?r zweckm??ig erachtet, einen ausf?hrlicher gehaltenen geographischen ?berblick ?ber das bereiste Gebiet voranzuschicken.[1 - Eine landeskundliche Studie ?ber den Nordostabhang des Kaukasus ist in Vorbereitung.] Insbesondere ist es mir dabei um eine kurze Charakterisierung der einzelnen tschetschenischen Landschaften bzw. Gaue zu tun, zumal ich bei den volkskundlichen Ausf?hrungen auch auf die geographische Verbreitung einzelner Erscheinungen innerhalb des Tschetschenengebietes n?her eingehe. Da ferner die tschetschenische Kultur keine Sonderkultur darstellt, sondern ?hnlichkeiten und ?bereinstimmungen mit der Kultur der ?brigen Kaukasusv?lker ?berall ersichtlich werden, so erschien es mir auch nicht unangebracht, die geographische Stellung des Tschetschenengebietes im Kaukasus kurz zu kennzeichnen.
Hierzu noch einige allgemeine Bemerkungen ?ber den Stand der v?lkerkundlichen Forschung in den Kaukasusl?ndern. Wie ?berall in der Welt, so verschwinden auch hier die alten Volkskulturen in ihren geistigen und materiellen Bestande immer mehr und mehr und werden durch die moderne Lebensf?hrung westeurop?ischer Herkunft verdr?ngt, die gerade durch den Krieg und besonders den Bolschewismus aufs intensivste verbreitet und bis in die entlegensten Gebirgst?ler getragen worden ist. Aber ebenso eifrig ist man dabei, das noch vorhandene aufzuzeichnen und in Museen zu sammeln, bevor es endg?ltig verschwindet. An dieser gegenw?rtig in vollem Gange befindlichen Arbeit ist jedoch der Anteil westeurop?ischer Forscher, die in fr?heren Jahrzehnten doch in vorderster Front standen, recht gering. Allerdings d?rfte das Interesse f?r den Kaukasus bei uns keineswegs nachgelassen haben, eher wohl im Gegenteil. Ganz unverh?ltnism??ig viel st?rker ist aber auf russischer Seite das Interesse f?r landes- und volkskundliche Forschung und f?r Kaukasuskunde im besonderen gestiegen. Unterst?tzt wird diese Bewegung durch eine straffe Organisation, die die zahlreichen j?hrlich in den verschiedenen Teilen des Reisenreiches arbeitenden Expeditionen nach einheitlichem Plane leitet. Das hat freilich seinen besonderen Grund auch darin, da? als Quelle f?r die hierzu notwendigen Mittel ausschlie?lich die Staatskasse in Frage kommt, wie es ja in einem kommunistischen Staate nicht anders m?glich ist. Vor allem aber mu? ber?cksichtigt werden – ein Umstand, der viel zu wenig bekannt ist —, da? die landes- und volkskundliche Forschung nicht blo? von den Russen betrieben wird, sondern da? die zahlreichen Fremdv?lker des Reiches, auf die sich die Untersuchungen doch haupts?chlich erstrecken, selbst schon tatkr?ftig dabei mitarbeiten, das eine mehr, das andere weniger. Gr??ere V?lker, wie das alte Kulturvolk der Georgier, haben das ja auch fr?her schon getan, aber bei den anderen kleinen Kaukasusv?lkern, besonders den Nordkaukasiern, ist der Sinn f?r Heimatforschung in der letzten Zeit erwacht bzw. k?nstlich geweckt worden im allgemeinen Zusammenhange mit der Nationalit?tenpolitik der Sowjetunion. Wesentlichen Anteil daran hat die Entwicklung des Volksbildungswesens. W?hrend meines Aufenthaltes genossen im Tschetschenengebiet ungef?hr 40% aller Kinder regelm??igen Schulunterricht, in den D?rfern der Ebene mehr, im Hochgebirge weniger. Es waren nur einige wenige, schwer zug?ngliche Hochgebirgst?ler, in denen noch keine Schule existierte. Die Fremdv?lker haben eben durch den Bolschewismus au?erordentliche Vorteile erhalten; auch als Gegner des Bolschewismus mu? man dies zugeben[2 - N?heres dar?ber enth?lt mein Aufsatz in der Zeitschrift «Osteuropa» 1928, Heft 10: «Vom kulturellen Leben in den kleinen Autonomen Gebieten des Nordkaukasus».]); ihre kulturelle Entwicklung ist auf Kosten der russischen Volksteile. Voll auswirken, besonders eben auch f?r die Heimatforschung, wird sich diese Wandlung der Dinge erst in einigen Jahren, wenn die j?ngere Generation der Fremdv?lker herangewachsen sein wird. Aber auch heute hat jedes der kleinen Autonomen Gebiete des Nordkaukasus – und in den anderen Teilen des Reiches ist es ebenso ? sein eigenes kleines heimatkundliches Museum. Zentren der Forschung sind die Museen und Institute von Wladikawkas und Petrowsk (Machatschkala), in denen st?ndige wissenschaftliche Kr?fte arbeiten, wovon periodische Ver?ffentlichungen zeugen. Hier wurde mir auch bereitwilligst Gastfreundschaft gew?hrt, wof?r ich auch an dieser Stelle danken m?chte.
So mu? derjenige, der heute Kaukasusforschung betreibt, ganz gleich, ob in natur- oder geisteswissenschaftlicher Richtung, sich eingehend mit den Arbeiten vertraut machen, die in den letzten Jahren von russischen Forschern und eingeborenen Kaukasiern an Ort und Stelle geleistet worden sind und noch werden, wenn seine Beobachtungen und die daraus gefolgerten Schl?sse dem jeweiligen Stande der Forschung entsprechen sollen. Freilich ist diese Forderung infolge des trotz mancher Bem?hungen noch mangelhaften Literaturaustausches nicht leicht zu erf?llen.
F?r die Reise standen mir nur sehr geringe Mittel zur Verf?gung. Ein gr??erer Betrag, der mir, als ich mich schon im Kaukasus befand, in gro?z?giger Weise vom Hamburger Museum f?r V?lkerkunde zum Erwerb v?lkerkundlicher Gegenst?nde noch zur Verf?gung gestellt wurde, kam infolge mannigfacher Schwierigkeiten leider nur zum kleinen Teile in meine H?nde. Einige der mitgebrachten Gegenst?nde sind hier ver?ffentlicht; die Anfertigung der betreffenden Zeichnungen geschah in dankenswerter Weise durch das Museum. Vom allem danke ich dem Leiter der kaukasischen Abteilung des Museums, Herrn Dr. A. Byhan, f?r sein oft bewiesenes freundliches Entgegenkommen. Manch wertvolle Anregung erhielt ich von meinem Freunde Dr. Friedlich Baumhauer, Osterode, Ostpr., auf Grund seiner auf eigenen Forschungen beruhenden eingehenden Kenntnis der georgischen Volkskunde.
Herrn Prof. Dr. Arved Schultz, dem Direktor des Geographischen Instituts der Universit?t K?nigsberg, des deutschen Institutes, das die besten M?glichkeiten f?r Studien zur allgemeinen Landeskunde des russischen Ostens bietet, gilt mein besonderer Dank f?r das rege Interesse und die F?rderung, die er meinen kaukasischen Arbeiten zuteil werden lie? sowie daf?r, da? die Ver?ffentlichung der vorliegenden Schrift in dieser Ausstattung erm?glicht wurde. (Naheres daruber enthalt mein Aufsatz in der Zeitschrift «Osteuropa» 1928, Heft 10 «Vom kulturellen Leben in den kleinen Autonomen Gebieten des Nordkaukasus»).
A. Geographische Grundlagen. I. Grenzlinien, Ausdehnung und Bev?lkerungszahl des Tschetschenengebietes
Im folgenden sei zun?chst kurz der Verlauf der Grenzen des Autonomen Gebietes der Tschetschenen angegeben.
Die S?d- und S?dostgrenze verl?uft l?ngs der Wasserscheide zwischen dem Flu?gebiet des Terek und des Ssulak, bzw. der Ssunscha und des Andischen Koissu. Sie zieht also vom Tebulos-mta die Pirikitelische Kette, bzw. den Basch-lam[3 - Der in der Literatur gebr?uchliche Name «Pirikitelische Kette», ein Wort georgischer Herkunft, ist am Nordhange des Gebirges vollkommen unbekannt. Der tschetschenische Name, der in dieser den Tschetschenen gewidmeten Arbeit allein verwendet werden soll, lautet «Basch-lam» (lam = Berg, Gebirge).]) entlang bis zum Diklos-mta und folgt dann in n?rdlicher Richtung der Andischen Kette bis in die Gegend des Sees Esen-am, ?stlich an diesem vorbeiziehend. Hier greift die Grenze s?dostw?rts ein wenig ?ber die Wasserscheide hin?ber. Vom Kerket-Pa? aus verl?uft sie wieder ostw?rts auf der andischen Wasserscheide, die sie erst bei den Quellen des Jarykssu endg?ltig verl??t. Sich nach Norden wendend zieht sie etwa 20 km auf der Wasserscheide zwischen dem Aktasch im Osten und dem Jarykssu im Westen entlang, ?berschreitet dann in nordwestlicher Richtung den letzten sowie die Wasserl?ufe des Jamanssu und n?rdlich der Bahn Grosny-Petrowsk auch des Akssai und erreicht den Terek bei der Stanize Schelkosawodskaja ungef?hr an der Stelle, an der er seinen Lauf nach Norden zu wenden beginnt. Die Nordgrenze wird nun ?berall durch den Terek gebildet. Etwa 20 km ?stlich von Mosdok verl??t sie den Terek und ?berschreitet in s?dlicher Richtung die H?hen des Terek-Ssunscha Gebirges. In der Ssunscha-Ebene bildet sie eine nach Westen offene Schleife und zieht dann, wieder in das Gebirge eindringend, auf der Wasserscheide zwischen den beiden Nebenfl?ssen der Ssunscha Assa und Fortanga nach S?ben zum Gebirgsknoten des Muiti-ker. Von hier steigt sie in s?d?stlicher Richtung ins Tal des oberen Argun hinab und erreicht, sich s?dw?rts wendend, wieder den Tebulos-mta.
Da die Tschetschenen in geschlossener Masse beisammen wohnen, so finden sich innerhalb der gezeigten, die in tschetschenischen D?rfern wohnen. Eine Ausnahme macht nur das ganz ?berwiegend russische Grosny mit seiner Erd?lindustrie, das bisher ein Verwaltungsgebiet f?r sich bildete, neuerdings jedoch zum Autonomen Gebiete der Tschetschenen geschlagen worden ist. Umgekehrt gibt es au?erhalb dieses autonomen Gebietes keine Tschetschenen, abgesehen von den Bewohnen einiger weniger D?rfer, die der Sowjetrepublik Daghestan zugeteilt worden sind.
Der Gesamtfl?chenraum des Gebietes mag nach roher Sch?tzung etwa 10 000 qkm betragen, w?rde also nur etwa ? der Fl?che Ostpreu?ens ausmachen. An Einwohnern zahlte man im Jahre 1926, 311 000 ohne die 95 000 Einwohner des Bezirkes von Grosny.
Wie ein Blick auf die Karte zeigt, besteht das Tschetschenengebiet aus einem gebirgigen und einem ebenen Teil, die ungef?hr gleich gro? sind.
II. Lage des Tschetschenengebietes im Gebirgsbau des Kaukasus
Der Gebirgszug des Kaukasus l??t sich zwanglos in drei gro?e Hauptteile zerlegen, eine Einteilung, die auch von den meisten Geographen bevorzugt wird, dr?ngt sie sich doch sozusagen von selbst auf. Die lange Kette gewaltiger Schneegipfel und Firnfelder im zentralen Teil wird zun?chst als Einheit empfunden. Der Grenzpunkt gegen die beiden ?u?eren Drittel kann verschieden gew?hlt werden. Der Geologe wird als Grenze nach Osten hin die Terekschlucht annehmen, da dort die kristallinen Gesteine unter die alten dunklen Schiefer des Ostkaukasus untertauchen; orographisch wird man als ?stlichen Grenzpunkt des zentralen Teils besser den Gebirgsknoten des gro?en Borbalo betrachten. Etwa 50 km westlich des Elbrus beginnt das westliche Drittel des Gebirges, das, rasch niedriger werdend, schlie?lich in der Halbinsel Taman sein ende findet.
Viel klarer als das westliche Drittel erscheint das ?stliche als eigenartiger, selbst?ndiger Gebirgsteil abgesetzt, der Daghestan. Dies m?chtige schildartige Dreieck scheint eigentlich nur eins mit dem ?brigen Gebirge gemeinsam zu haben: die gleichsinnige, geradlinig fortgesetzte Erstreckung des wasserscheidenden Kammes von WNW nach OSO. Der ganze S?dhang des Kaukasus fehlt hier; er ist abgesunken. An seiner Stelle breitet sich daf?r die sonnige Ebene Kachetiens. Scharf, wie abgeschnitten, liegen hier Hochgebirge und flache Niederung unvermittelt nebeneinander. Man vergleiche damit die breite Entwicklung des S?dhanges im zentralen und westlichen Kaukasus. Aber auch der stehengebliebene Nordhang des Daghestans ist in seiner Gliederung und in seinem Aufbau grundverschieden von dem des zentralen Kaukasus.
Seit langem unterscheidet man am Nordhang des Kaukasus mehrere parallele Ketten, die bald mehr, bald weniger klar zu erkennen sind. Allen Teilen des Gebirges gemeinsam ist der Hauptkamm. Diesen Namen f?hrt er nicht deswegen, weil sich in ihm das Gebirge zu seiner gr??ten H?he erhebt, sondern weil er die Wasserscheide ?berall bildet; nirgends wird er von einem Flusse durchbrochen. Die h?chsten Erhebeungen finden sich vielmehr in dem ihm n?rdlich vorgelagerten sogenannten Seitenkamme, wie Elbrus, Koschtan-tau, Dych-tau und Kasbek. Durch viele Quert?ler erscheint er in einzelne Massive aufgel?st. Mehrfach ist er durch Querjoche mit dem Hauptkamme verbunden, nach S?dosten glaubt man im hohen Basch-lam und der Bogosgruppe im Daghestan zu erkennen.
Weiter unterscheidet man den Felsigen Kamm (skalistyi chrebjet der Russen), darauf folgend den Almenkamm (pastbischtschnyi chr.) und schlie?lich den oder die Waldigen K?mme (ljessistyi chr.). Was jedoch den Felsigen Kamm anbelangt, so mu? bemerkt werden, da? dieser Name im zentralen Kaukasus gepr?ht wurde, wo diese Kette gr??ere H?hen erreicht als ?stlich der georgischen Heerstra?e; im Tschetschenengebiete zeigt er nur noch stellenweise felsigen Charakter; der Felsige Kamm ist hier gr??tenteils genau so mit Almen bedeckt wie der n?rdlich von ihm sich hinziehende sogenannte Almenkamm.
Diese langen, durch viele Quert?ler in einzelne Teile aufgel?sten parallelen Kettenz?ge sind charakteristisch f?r den zentralen Kaukasus. Die ?u?eren Ketten werden zwar durch den Einbruchskessel von Wladikawkas teilweise unterbrochen; doch ist ?stlich der Georgischen Heerstra?e die ganze Reihenfolge der K?mme, vom Hauptkamm bis zu den Waldigen K?mmen, wieder klar zu erkennen. Das gilt noch f?r die ganze westliche Tschetschnja[4 - Russische Bezeichnung f?r das Gebiet der Tschetschenen.]), doch nur bis zum Argun. ?stlich dieses Flusses tritt mit Macht eine andere Erhebungsrichtung in Erscheinung, die von SW nach NO zieht und die bisher ausschlaggebende Richtung WNW-OSO weitgehend verdr?ngt. Diese Erhebungsrichtung SW-NO ist bestimmend f?r die Gestaltung des Daghestans. Dadurch kommt ein fremdes Element in das System des Kaukasus, das seinen bis dahin so einheitlichen Charakter ganz verwischt. Gleich einer ungef?gen schweren Masse, gleich einem Fremdk?rper scheint der Daghestan in dem sonst so wohlgeordneten Kettengef?ge des Kaukasus zu h?ngen. Abgesehen von der anderen Orientierung seiner Gebirgsz?ge ist es vor allem die seltsame Abgeschlossenheit, die den Daghestan so aus dem Rahmen des ?brigen Kaukasus herausfallen l??t. Ein m?chtiger Kalkgebirgswall umschlie?t ihn im NW, N und O und zwingt die Wasser der vier Koissufl?sse, sich in einem tiefen Canon von seltener Gro?artigkeit sich durch diese Mauer einen Ausweg zum Kaspischen Meere zu bahnen.
Eigenartiger Faltenbau und tiefgreifende Erosion haben besonders im tiefer gelegenen nordwestlichen Teile dieser riesigen nat?rlichen Festung ein chaotisches Durcheinander von scharfen K?mmen, breiten, rings isolierten blockartigen Plateaus und tiefen Schluchten geschaffen, in dem es selbst von erh?htem Standpunkt aus schwierig ist, sich zu orientieren. Erst bei genauerem Studium erkennt man, da? auch dieses vermeintliche Chaos gesetzm??ig gestaltet ist.
Es ist hier nur die Rede vom inneren Daghestan mit den vier Koissu-Fl?ssen; au?er Betracht bleibt das ganze Gebirgsland zwischen diesem Koissu-Daghestan und dem Kaspischen Meere, also das Schach-dagh- und Dibrarsystem, da es f?r das hier n?her zu behandelnde Gebiet keine Bedeutung besitzt.
Der Gebirgszung, bei dem diese bedeutungsvolle SW-NO Richtung am auff?lligsten in Erscheinung tritt, ist gleichzeitig ein Teil jenes schon erw?hnten Grenzwalls, der den Daghestan rings gegen die Au?enwelt abschie?t. Auf ihm verl?uft die Wasserscheide zwischen dem flu?gebiet des Sulak und dem des Terek; auf ihm zieht auch die politische Grenze entlang, wie schon eingangs erw?hnt wurde. Sein Au?enhang liegt ganz im Bereich der Tschetschnja; er ist der hervorstechendste Zug in der Orographie ihres ?stlichen Teils.
Die Folgerungen daraus ergeben sich nunmehr von selbst. In der Tschetschnja treffen die beiden gro?en Einheiten, des kaukasischen Gebirgsbaues aufeinander, das Kettengef?ge des zentralen Kaukasus und der quer dazu liegende daghestanische Block. Der westliche Teil ist im zentralkaukasischen, der ?stliche im daghestanischen Sinne beeinflu?t. Man kann somit die Tschetschnja als ?bergangsgebiet zwischen dem Nordhang des zentralen und des ?stlichen Kaukasus bezeichnen.
Ebenso wie das Gebirge l??t sich auch Ziskaukasien oder, wie die Russen sagen, der Nordkaukasus in drei Hauptteile zerlegen. Es sind dies das Kubangebiet im W, in der Mitte die Stawropoler H?hen und im O die Niederung des Terek und der Kuma.
Das ?stliche Drittel Ziskaukasiens, mit dem wir es hier allein zu tun haben, zerf?llt in zwei klar von einander geschiedene Teile. Der n?rdliche Teil, die weite, zwischen Terek und Kuma sich breitende Nogaier-Steppe, kann hier, wo es sich im wesentlichen nur um Feststellung der orographischen Beziehungen handelt, au?er Betracht bleiben, da solche zum Tschetschenengebiet nicht vorhanden sind. Auch mit dem ?brigen Gebirge steht sie nicht in Zusammenhang; kein Bergwasser durchrauscht sie; Kuma und Terek bilden nur die Grenzen der ?den, teilweise w?stenhaften Steppen.
Anders das sich s?dlich anschlie?ende Gebiet, die dem Gebirgsfu? unmittelbar vorgelagerte Niederung. Ich nenne sie die obere Terekniederung, wobei ich jedoch auch die Niederung seines sehr selbst?ndigen gr??ten Nebenflusses, der Ssunscha, mit einbegreife, der den Terek erst zu Beginn seines Unterlaufes erreicht. Diese Niederung wird von zahllosen Bergwassern durchstr?mt; sie ist geradezu ihr Werk, insofern als sie aus z. T. mehrere hundert Meter m?chtigen Schottermassen besteht, unter denen die in die Tiefe gehenden kaukasischen Falten begraben liegen. Diese Falten tauchen jedoch in einiger Entfernung vom Gebirgsfu? pl?tzlich wieder empor und zwar in zwei langgezogenen parallelen Bodenw?llen von etwa 200 – 300 m relativer H?he. Man bezeichnet sie als das Terek-Ssunscha-Gebirge. Doch steht es auch oberfl?chlich mit dem Hauptgebirge noch in Verbindung. Der n?rdliche Zug h?ngt im O mit ihm etwa da zusammen, wo der Daghestan am weitesten nach N vorst??t; im W wird er durch die Fluren der Kabarda von ihm getrennt. Der s?dliche wiederum h?ngt mit seinem Ostfl?gel sozusagen in der Luft; unvermittelt bricht er in der Ssunscha-Ebene ab; auf seinen letzten H?geln ragen die Bohrt?rme der neuen Grosnyer Erd?lfelder in die H?he. Im W dagegen findet er den Anschlu? zur Hauptkette, kurz nachdem er vom Terek durchbrochen wird, ?hnlich wie im O sich die Ssunscha durch den n?rdlichen ihren Weg bahnt. Die Falten des Terek-Gebirges sind nach neueren Untersuchungen nach N ?berkippt; auf St?rungen deutet u. a. die starke Therment?tigkeit an seinem Nordrande, z. B. n?rdlich von Grosny.
Zwischen diesen beiden H?gelk?mmen und dem Hauptgebirge breitet sich die obere Terek-Niederung. In einem weiten Bogen dringt sie in das Gebirge ein, am tiefsten bei Wladikawkas, und verleiht damit dem zentralen Kaukasus die eigent?mlich enggeschn?rte Gestalt, so da? die Breite des Gebirges hier auf 120 km zusammenschrumpft, w?hrend sie im Elbrusgebiet 180 km und im Daghestan nicht viel weniger betr?gt. Die Ziffer von 180 km hat jedoch auch f?r den zentralen Kaukasus ihre Bedeutung; sie w?rde n?mlich der Entfernung vom S?dfu? des Gebirges bis zum Nordrand der beiden H?gelk?mme entsprechen, was gewi? mehr als blo?er Zufall ist.
Die zum Bogen der oberen Terek-Niederung geh?rende Sehne wird also ungef?hr durch den n?rdlichen der beiden H?gelk?mme gebildet oder, wenn man will, durch den Mittellauf des Terek, der hier in streng kaukasischer Richtung am Nordhang des n?rdlichen H?gelkammes entlangflie?t, bis er, vielleicht unter dem Einflu? der daghestanischen Erhebungsrichtung SW-NO, nach NO abbiegt.
Man darf mithin die obere Terek-Niederung bei einer Betrachtung des kaukasischen Gebirgsbaues nicht au?er Acht lassen. Man kann sie sowohl als innerhalb, wie als au?erhalb des Gebirges liegend ansehen. F?r ersteres spricht in interessanter Weise eine anthropogeographische Tatsache, insofern n?mlich, als sie noch von den eigentlichen Kaukasusv?lkern besiedelt wird, n?mlich den Kabardinern, Inguschen und Tschetschenen, w?hrend jenseits der beiden H?gelz?ge das turko-tatarische Steppenvolk der Nogaier und die zur selben V?lkergruppe z?hlenden Kum?ken sich ausbreiten. In sich besteht die obere Terek-Niederung aus drei voneinander getrennten Gebieten, n?mlich der Kabarda und dem Kessel von Wladikawkas, der von jener durch den s?dlichen der beiden H?gelk?mme getrennt wird. Durch einen Vorsprung der Schwarzen Berge wird der Wladikawkaser Kessel vom dritten Teil geschieden, der Ssunscha-Ebene, die f?r sich ebenfalls wieder bogenf?rmig ins Gebirge eindringt. Die Ssunscha-Ebene nun bildet das Gebiet, dessen Stellung es in diesem Kapitel zu kennzeichnen galt, n?mlich den ebenen Teil des Tschetschenengebietes.
Diese kurze Skizzierung der Lage des Tschetschenengebietes im Kaukasus mag f?r den Rahmen der vorliegenden Arbeit gen?gen.
III. Landeskundlicher ?berblick ?ber das Tschetschenengebiet.
a) Oberfl?chengestalt. Die Aufz?hlung der verschiedenen Ketten, wie sie f?r den Nordhang, des zentralen Kaukasus ?blich ist und auch im vorigen Kapitel gebracht wurde, k?nnte die Vorstellung erwecken, da? wir hier parallel dem Hauptkamme eine Reihe von Ketten antreffen, von denen eine immer niedriger wird als die andere, bis sie schlie?lich in der Ebene verklingen. Im Osten ist dies ganz bestimmt nicht der Fall, vor allem nicht im Daghestan, aber auch nicht im Tschetschenengebiet. So sind hier z. B. die beiden K?mme, die zwischen dem Hochgebirge und den niedrigen Schwarzen Bergen liegen, einander an H?he gleich, ja stellenweise ?berragt sogar der n?rdliche den s?dlichen. Am ehesten geeignet, einen raschen ?berblick ?ber die Orographie des Gebietes zu verschaffen, ist eine Einteilung nach den verschiedenen H?henstufen, die sehr scharf ausgepr?gt sind und das Auge des Bergwanderers zu dieser Einteilung geradezu zwingen. Es sind ihrer drei zu unterscheiden. I. Die Stufe der terti?ren Vorberge oder «Schwarzen Berge» mit etwa 800—1000 m H?he. Darauf nach S folgend 2. Die Stufe des Kalkgebirges der Kreide und des oberen Jura von 2000 m ab mit Gipfelh?hen bis zu 3000 m. Zu dieser H?henstufe geh?rt noch ein Teil des Schiefer- und Sandsteingebirges des mittleren und unteren Jura. 3. Das Hochgebirge der alten dunklen Schiefer von etwa 3000 m ab bis 4500 m.
Betrachten wir zun?chst die terti?ren Vorberge. Aus der Ssunscha-Ebene, die am Gebirgsfu? etwa 300 m noch liegt, steigen ihre sanftwelligen H?hen empor, nach den dichten Buchenw?ldern, mit denen sie einst bedeckt waren, «Schwarze Berge» genannt. Die O-W streichenden Falten sind durch die zur Ssunscha eilenden Fl?sse und B?che in einzelne Kuppen und S-N ziehende R?cken aufgel?st, von denen einige 1200 m erreichen. Bemerkenswert ist in diesem Gebiet die gewaltige eiszeitliche Schotterverh?llung, die, von den Flu?terrassen abgesehen, ausgedehnte tischglatte Aufsch?ttungsebenen zwischen den H?henz?gen gebildet hat, die bis zu 30 qkm Fl?chenraum einnehmen k?nnen. Sie bestehen ausschlie?lich aus Kalkger?ll und werden durch die Flu?terrassen wie durch schmale B?nder mit den Schottern der Ssunscha-Ebene verbunden. Die Breite der Schwarzen Berge verringert sich um so mehr, je tiefer die Ssunscha-Ebene in das Gebirge eindringt. So betr?gt sie am Argunlauf und westlich von ihm nur etwa 15 km, w?hrend sie im O des Gebietes auf das doppelte anw?chst.
V?llig unvermittelt erhebt sich aus den Schwarzen Bergen die zweite H?henstufe des Kalkgebirges, bei dem selbst die Pa?h?hen kaum unter 2000 m herabreichen (von den Durchbruchst?lern nat?rlich abgesehen). Viel undeutlicher ist die s?dliche Begrenzung dieser H?henstufe; der Anstieg zum Hochgebirge erfolgt allm?hlich. Im allgemein beginnt das Hochgebirge erst s?dlich der beiden Argun-Oberl?ufe. Der Tschanti-Argun bildet die Grenze zwischen beiden H?henstufen jedoch nur bis zur Einm?ndung des Chotscharoi-Baches (von rechts), der Scharo-Argun bis zu der der Kiri-Baches (von rechts). Unterhalb dieser Punkte greift die H?henstufe des Kalkgebirges bei beiden Flu?l?ufen auf das rechte Ufer ?ber.
Die Breite dieser Stufe betr?gt im Tschetschenengebiet 25—30 km. Viel breiter wird sie im Daghestan.
Senkrecht zur Gebirgsachse gemessen, h?lt sich n?mlich in der Linie von Chunsach das Gebirge in einer Tiefe von etwa 60 km ungef?hr in der H?he von 2000 m und dar?ber (Chunsach selbst nur 1800 m). Diese Feststellung wird hier besonders erleichtert durch die ausgedehnten, f?r den Daghestan charakteristischen Plateaulandschaften, z. B. der von Chunsach. Hand in Hand mit dieser Verbreiterung geht auch eine solche des Bereichs der verschiedenen geologischen Formationen. Der Nordhang des Daghestan scheint sich eben zum Ausgleich f?r den fehlenden S?dhang um so breiter entfaltet zu haben. Er st??t ja auch, auf die Gebirgsachse bezogen, viel weiter nach N vor als im ?brigen Kaukasus, wobei der Nordrand seines Kalkgebirges, n?mlich die Andische Kette, wesentlich h?her aufragt als dessen Mitte, ebenso, wie er auch die benachbarten tschetschenischen Kalkberge ?berragt. Man kann das seitlich schon von der Bahn beobachten, wenn man sich von W kommend Grosny n?hert. W?hrend das niedrigere tschetschenische Kalkgebirge die Waldgrenze stellenweise nur unwesentlich ?bersteigt, winken von O, besonders im Abendschein, die j?hen Steilabst?rze des 3040 m hohen Buzrach her?ber, die mit ihren hellen Farben einen wirkungsvollen Kontrast zum Gr?n der W?lder am Fu?e bieten. Der Abfall der Andischen Kette macht hier geradezu den Eindruck einer Landstufe, so besonders am Zobolgo (2910 m) und von ihm aus noch etwa 15 km weiter nach O. Den Fu? dieser Landstufe, deren Schichten nach meinen Beobachtungen nach SO einfallen, benagen die weit verzweigten Quellfl?sse des Akssai.
Anders die Nordseite der Andischen Kette weiter ?stlich im Salatau-Gebiet, das schon zur Republik Daghestan geh?rt. Die Schichten fallen hier leicht nach N ein, wie ich es beim Durchwandern des wahrhaft grandiosen Ssulak-Canons gut beobachten konnte; daher erfolgt dort der Anstieg von N her allm?hlich. Ganz flach ist der Au?enhang der Andischen Kette besonders jenseits des Ssulak in Richtung Temir-Chan-Schura.
Die f?r den Daghestan bezeichnenden Plateaubildungen fehlen im Tschetschenengebiet, wenn sich auch auf den H?hen des Kalkgebirges stellenweise ziemlich ausgedehnte ebene Fl?chen vorfinden. Das Gesichtsfeld beherrschen vielmehr zwei ausgesprochene Ketten, besonders im W. Die n?rdliche, deren Nordrand durchweg leicht verkarstet ist, wird in ihrer Westh?lfte durch Quert?ler in mehrere Massive aufgel?st. Freilich sind diese T?ler infolge ihrer canonartigen Ausbildung eher verkehrshindernd als —f?rdernd, z. B. das der Gechi, wenn nicht wie im Tschanti-Argun-Tal, eine k?nstliche Stra?e angelegt ist. ?stlich des Scharo-Argun bildet sie einen zusammenh?ngenden R?cken, der in seiner weiteren Fortsetzung in der Andischen Kette bis zum Kaspischen Meere hin nur noch einmal im Ssulak-Canon durchbrochen wird.
Etwa 15 km weiter nach S folgt, parallel ziehend, die ungef?hr gleich hohe zweite Kette dieser H?henstufe. Dazwischen liegt eine ziemlich flache Mulde, in die sich ebenfalls noch tiefe Schluchten eingegraben haben. Diese zweite Kette bildet die unmittelbare Fortsetzung des hohen Zori-lam Inguschiens[5 - Russ.: «Ingu?ija». Dies ist die vom Inguschen-Institut in Wladikawkas neueingef?hrte Bezeichnung. Bis dahin bediente man sich gew?hnlich des georgischen Wortes «ingu?eti», d. i. Ingeschenland, russ.: «ingu?etija», Inguschetien.]), erniedrigt sich etwas im westlichen Tschechenengebiet, erreicht im Rindschikort, hart am Durchbruch des Scharo-Argun, wieder 3000 m und st??t weiterhin als Indoi-lam mit der Andischen Kette zusammen. Sie bildet die Nordumrandung des Tschanti-Argun-Oberlaufes und wird nur von den beiden Argunl?ufen durchbrochen. Im Gegensatz zu der n?rdlichen Kette ist sie in ihrer Gesteinsbeschaffenheit nicht einheitlich. W?hrend sie im W haupts?chlich wohl aus m?rben feinbl?ttrigen Schiefern und Sandsteinen besteht, herrscht im O, besonders im Rindschi-kort, wieder Kalk vor. Dementsprechend haben auch die Berge verschiedene Formen. Dort in der n?rdlichen Kette die schroffen, hellen, dolomitischen Bauten z. B. des Gilla-kort und Naschacho-lam mit ihrem harten Nebeneinander von horizontalen und vertikalen Linien, hier die weicheren, offenen Formen des dunklen Schiefergebirges.
Der Anstieg zum Hochgebirge des Baschl-lam erfolgt von der eben geschilderten H?henstufe aus allm?hlich, nicht mit dem pl?tzlichen Ruck, mit dem sich die Nordfront des Kalkgebirges aus den tertia?ren Vorbergen erhebt. Den Anstieg vermitteln die zahlreichen, im rechten Winkel vom Hochgebirge ausstrahlenden, gratartig zugesch?rften Querrippen, zwischen denen die Gletscherb?che zu den beiden L?ngst?lern des Tschanti- und Scharo-Argun-Oberlaufes herabbrausen. Die Kette des Basch-lam zweigt am gro?en Borbalo vom wesentlich niedrigeren wasserscheidenden Hauptkamme ab, schwenkt am Tebulos ebenfalls in die allgemein-kaukasische Richtung WNW-OSO um und bildet als hohe Mauer vom etwa 45 km L?nge die S?dgrenze des Tschechenengebietes. Auf daghestanischem Gebiete findet sie ihre Fortsetzung in der fast ebensohohen Bogos-Gruppe, wird von ihr jedoch durch den tiefen Spalt getrennt, den der Andische Koissu eingegraben hat. Andererseits aber geht sie von ihrem Ostpfeiler, dem 4190 m hohen Diklos-mta, unmittelbar in die scharf nach NO vorsto?ende Andische Kette ?ber, die bis zum Auftreffen auf den schon erw?hnten W-O ziehenden Indoi-lam ?ber 3000 m bleibt.
Durch den ziemlich tiefen Sattel, ?ber den aus dem Childecheroi-Tale (zum Tschanti-Argun) der zur Not auch im Winter gangbare Pa? Jukerigo (3000 m) nach Tuschetien f?hrt, wird vom Basch-lam der im allgemeinen noch zu ihm gerechnete Stock des Tebulos-mta abgetrennt, der mit 4507 m die h?chste Erhebung des Kaukasus ?stlich der Georgischen Heerstra?e darstellt und von den Eingeborenen immer noch f?runerstiegen, ?berhaupt unersteigbar gehalten wird, ebenso wie die ?brigen Gipfel des Basch-lam. Auch der Name Tebulos-mta ist bei den Tschetschenen, insbesondere ihrem unmittelbar n?rdlich davon im Maisti-Tale wohnenden Stamme der Kisten, unbekannt; mir wurde von ihnen der Name Dakko-kort angegeben. Weiter im N wird er von den dort wohnenden Russen auch als Maisti-Berg bezeichnet. Ebenso hat auch der h?chste Berg des Basch-lam, Komito (4272 m), bei den Tschetschenen eine eigene Bezeichnung, n?mlich Datach-kort.
Der erw?hnte Pa? Jukerigo ist ?brigens nur f?r die Childecheroi-Leute benutzbar und f?r den s?dlich des Basch-lam wohnenden georgischen Stamm der Tuschen, die ?ber ihn ihre Schafe nach den Winterweiden am Terek treiben. Der hohe und schroffe Childecheroi-R?cken, der bis hart an die Schneegrenze aufsteigt, hindert die Bev?lkerung des Scharo-Argun-Tales an seiner Benutzung. Dieselben m?ssen, wenn sie nach Tuschetien wollen, den viel h?heren, ?ber Gletscher f?hrenden Katschu-Pa? (3550 m) ?berschreiten, der aber nur wenige Monate gangbar ist. Eine georgische Truppe, der ich im Jahre 1919 angeh?rte, mu?te ihn allerdings noch Anfang November ?berschreiten; freilich w?re ihr das Wagnis bald zum Verh?ngnis geworden. Andere ?berschreitbare Einschartungen weist der Basch-lam nicht auf.
Die Schneegrenze liegt etwa bei 3500 m, die Gletscherenden bei 2800 m; die eiszeitlichen reichten 1000 m tiefer herab, was an ausgepr?gten Trogt?lern noch erkennbar ist. Die Tr?ge gehen in steile Kerbt?ler ?ber, denen beim Austritt aus dem Hochgebirge im niederen Schiefergebiet sehr breitsohlige Talweitungen folgen, die beim Eintritt in das Kalkgebirge ihrerseits wieder durch typische Canons ababgelost werden.
Der Anblick, den der Basch-lam von N bietet, besonders vom Pa? Itum-Kale-Scharoi, kann ohne ?bertreibung als gro?artig bezeichnet werden. Drei durch un?bersteigliche Eismauern verbundene Gipfel, die noch weit in die nordkaukasische Ebene hinaus gr??en, sind seine Wahrzeichen. Sie sind von einander grundverschieden und doch jeder charaktervoll gestaltet: der elegante, schlanke, blendend wei?e Kegel des Datach-kort im W, die von S nach N ansteigenden und ungemein steil abfallenden Grate und Spitzen des Donos-mta in der Mitte und der massige breite Klotz des Diklos-mta im O, dessen breite Flanken ausgedehnte Firnfelder tragen, auf denen die abendlichen Sonnenstrahlen einen rechten Haltepunkt finden.
b) Gew?sser. Der einzige Flu?, der das tschetschenische Hochgebirge entw?ssert, ist der Argeun oder vielmehr seine beiden Arme Tschanti- und Scharo-Argun. Der Tschanti-Argun entw?ssert vom Hochgebirge das Chotscharoi- und Childecheroi-Gebiet, den Tebulosstock und die Strecke des teilweise schon von Chewsuren bewohnten Hauptkammes bis zum Wega-lam, der Grenze gegen Inguschien, der Scharo-Argun den Basch-lam. Im Kalkgebirge nehmen beide nur noch unbedeutende B?che auf. Es sind ?brigens zwei durchaus selbst?ndige Flu?l?ufe gebildet sind. Der Winkel, mit dem sie aus dem L?ngsoberlauf im Schiefergebirge in den das Kalkgebirge quer durchbrechenden Mittellauf ?bergehen, ist ungef?hr der gleiche; verschieden ist nur die Richtung. Der ganze Laufwinkel des Scharo-Argun ist um etwa 50 Grad nach W auf den Tschanti-Argun zu abgedreht, so da? schlie?lich beim Austritt auf die Ebene die Vereinigung erfolgt. Diese Abdrehung geschieht unter dem offenbaren Einflu? der Andischen Kette, deren Wichtigkeit in physiogeographischer und, wie sich noch zeigen wird, in anthropogeographischer Hinsicht nicht leicht ?bersch?tzt werden kann. Auch die Flu?l?ufe spiegeln eben die Tatsache wieder, da? der tschetschenische Westen im zentralkaukasischen Sinne, der Osten im daghestanischen Sinne beein?t ist.
Auch die ?brigen kleineren Fl?sse des Tschetschenengebietes folgen im allgemein entweder der einen oder der anderen Richtung; die westlichen der Tschanti-, die ?stlichen der Scharo-Richtung, wenigstens innerhalb der Berge und soweit sie der Ssunscha zustr?men. Letztere selbst kommt aus Inguschien unweit Wladikawkas und zieht als Sammler am Nordrand der Ebene zum Terek.
Der kr?ftigere Tschanti-Argun hat sein Bett wesentlich tiefer eingegraben als der Scharo-Argun und treibt sein Einzugsgebiet offenbar immer weiter gegen diesen vor, so da? die Wasserscheide schon viel n?her am Scharo- als am Tschanti-Argun liegt. Besonders deutlich wird das auf der flachen Wasserscheide ?stlich Schatoi. Vielleicht wird hier einmal der st?rkere den schw?cheren zu sich her?ber holen.
Selbst?ndig sind die Fl?sse, die ?stlich des Katschkalyk-H?henzuges, der die Ssunscha-Ebene im O begrenzt und das ?stliche Glied der Terek-Ssunscha-H?hen darstellt, mit welchem sie sich wieder an den Kaukasus anschlie?en, auf die hier schon gr??tenteils von Kum?ken bewohnte Ebene hinaustreten. Sie erreichen weder das Meer, noch Terek oder Ssulak, sondern enden in S?mpfen.
Alle tschetschenischen Flusse, mit Ausnahme der Argune, k?nnen zur Zeit des Niedrigwassers, also im Herbst und Winter, durchwatet werden, im Fr?hling und Sommer sind sie dagegen bei der allgemeinen Br?ckenlosigkeit gro?e Verkehrshindernisse.
c) Klima. Wie in allen Gebirgen, so bestehen auch im tschetschenischen Kaukasus gro?e klimatische Unterschiede zwischen dem Au?enrand und den inneren Gebirgslandschaften, die sich vor allem in den Feuchtigkeitsverh?ltnissen kundtun. Der Au?enrand bzw. die terti?ren Vorberge und die Nordfront des Kalkgebirges erhalten starke Niederschl?ge, im Inneren dagegen fallen geringere Niederschl?ge und besonders in den tiefen T?lern herrscht gradezu Trockenheit, ja D?rre. Typisch f?r das erstere Gebiet sind die Niederschlagsverh?ltnisse der Station Wedeno in Itschkerien (730 m. ?. d. M.) An Ort und Stelle wurde mir f?r das Beobachtungsjahr 1926/27 ein Betrag von 955 mm angegeben. Der russische Forstmann Markowitsch (Lit. Verz. 27) gibt dagegen die mittlere Niederschlagsmenge f?r f?nf Beobachtungsjahre (Jahreszahlen nicht angegeben, vermutlich aus den 90er Jahren) mit 845 mm an. Es darf jedoch ohne Weiteres angenommen werden, da? an dem dicht bewaldeten Anstieg zum Kalkgebirge, etwa in 1300 bis 1500 m H?he, die Niederschl?ge noch reichlicher ausfallen. Wesentlich weniger Niederschl?ge werden in Schatoi (560 m) gemessen, n?mlich 675 mm f?r 1926/27. Schatoi liegt zwar schon im Kalkgebirge, doch gestattet hier augenscheinlich die ?ffnung des Arguntales den Wolken den Eintritt in das Berginnere. F?r die ?brigen Gegenden des tschetschenischen Kalk- und niederen Schiefergebirges m?ssen niedrigere Ziffern in Ansatz gebracht werden. Da tschetschenische Stationen f?r dieses Gebiet leider nicht existieren, so mu? ich zum Vergleich Stationen aus dem nordwestlichen Daghestan heranziehen. Nur mu? dabei ber?cksichtigt werden, da? es dort noch trockener ist als im Tschetschenengebiet, aus zwei Gr?nden: erstens liegt es schon weiter nach O, also weiter vom feuchtigkeitspendenden Schwarzen Meere weg und zweitens erreicht hier die Nordumrandung, wie im vorangehenden gezeigt, gr??ere H?hen und ist au?erdem nicht durch Flu?t?ler unterbrochen. Ferner schlie?t die Andische Kette den Daghestan nicht blo? gegen N ab, sondern auch gegen W und im O h?lt sie etwaige vom Kaspischen Meere kommende Wolken fern. In Frage kommen die Stationen Tloch (582 m) und Botlich (700 m), beide tief im Tal des Andischen Koissu gelegen, mit 459 und 418 mm Regenmenge. Auf den Hochplateaus, die im Daghestan durchschnittlich 1200 m ?ber den sie begrenzenden Schluchten liegen, fallen etwas mehr Niederschl?ge, so auf dem Plateau von Chunsach (1700 m) 588 mm. (Zahlen nach Dobrynin: Lit. Verz. 11). Mit der angegebenen Einschr?nkung wird man diese daghestanischen Daten auch als ungef?hren Anhaltspunkt f?r die Beurteilung der Niederschlagsverh?ltnisse in den entsprechenden Gegenden der inneren tschetschenischen Berge betrachten d?rfen, so besonders f?r Tschaberloi, Itum-Kale, Scharoi und Galantschotsch. Die Niederschl?ge fallen ganz ?berwiegend im Sp?tfr?hling und Sommer, der Herbst ist wundervoll trocken und die sch?nste Jahreszeit dieser Gegenden, besonders auch f?r den Reisenden.
Der j?hrliche Gang der Temperatur zeigt gem??igte Kontinentalit?t, die nur um ein geringes gr??er ist als etwa im deutschen Nordosten. Auch die Temperaturziffern sind in 800 m H?he nicht wesentlich von denen Nordostdeutschlands verschieden. Zu bemerken ist, da? die Sommertemperatur in den inneren T?lern h?her ist als am Nordrande des Gebirges: Wedeno: Jan. – 3, 8; Aug. 19, 8 (nach Markowitsch). Botlich dagegen Jan. – 3, 8; Juli 21, 4.
Infolge der gr??enen Trockenheit ist der Aufenthalt im Inneren der Berge viel angenehmer als in den Vorbergen. Die dichten Buchenw?lder des Nordhanges sind eigentlich immer feucht und selbst im Oktober fand ich den Boden noch derart morastig, da? das Wandern keine Freude war, obwohl seit Wochen kein Regen gefallen, die sich nur deswegen hatten dorthin versetzen lassen, um das trockene und gesunde Klima genie?en zu k?nnen, und die daf?r alle Unzul?nglichkeiten in kultureller Beziehung gern in Kauf nahmen. Neben ihren vielen, vielen anderen Projekten plant die tschetschenische Regierung hier auch die Errichtung von Gesundheitsstationen f?r Schwinds?chtige. Und wenn im Winter in den Vorbergen eine hohe Schneedecke Berg und Tal ?berzieht und ein unangenehm kalter Nebel die Stimmung raubt, dann strahlt in den inneren Bergen die Sonne vom blauen Himmel und h?lt die nach S gerichteten H?nge meist schneefrei, sofern ?berhaupt gr??ere Schneemassen fallen. Selbst betr?chtliche K?ltegrade lassen sich leicht ertragen und die Bewohner sitzen wintertags genau so im Freien auf den flachen D?chern wie in der warmen Jahreszeit.
Begreiflicherweise ist es auch in der Ssunscha-Ebene erheblich trockener als in den Vorbergen. Immerhin fallen in Grozny noch gegen 500 mm; doch nehmen die Niederschl?ge mit wachsender Entfernung vom Gebirge rapide ab, so da? am W-O Lauf des Terek, der die Nordgrenze des Tschetschenen-Gebietes bildet, nur noch 382 mm gemessen werden (Stanize Schelkosawodskaja), hier also schon das Klima der nordw?rts endlos sich breitenden ?den Nogaiersteppe herrscht. Hier ist auch die j?hrliche Temperaturschwankung wesentlich gr??er als in den Bergen, hervorgerufen vor allem durch die gr??ere Sommerhitze: Jan. – 3; Juli 24, 5 (nach Dobrynin, Lit. Verz. Nr. 11). Grosny: Februar – 3, 6 (?); August 24,4 (128 m ?. d. M.) (Nach Radde: Lit. Verz. 35, S. 28).
d) Pflanzendecke. Wie schon mehrfach erw?hnt, tragen die Vorberge und der Nordhang des Kalkgebirges ein dichtes Waldkleid, das haupts?chlich aus Buchen besteht, daneben auch aus Ulmen, Eschen, Linden, Ahorn u. a. Auch die Haselnu? ist weit verbreitet. Nadelwald fehlt vollkommen. Freilich hat sich das Bild in den vergangenen 100 Jahren sehr ung?nstig ver?ndert. Auf weiten Gebieten sind die alten sch?nen W?lder verschwunden. In voller Urspr?nglichkeit halten sie sich nur noch am Nordhang des Kalkgebirges und auch hier nur an schlecht erreichbaren Stellen, da allerdings in teilweise wirklich herzerhebender Pracht. Die Kuppen der Vorberge tragen nur noch einen jammervoll verhackten Buschwald oder sind schon ganz kahl und unter dem Pfluge. Den Ansto? zur allm?hlichen Entwaldung gaben die kaukasischen Kriege. Um die Unterwerfung der Tschetschenen durchf?hren zu k?nnen, insbesondere um vor ?berf?llen sicher zu sein, schlugen die Russen kilometerbreite Schneisen kreuz und quer durch die ber?chtigten Itschkerischen W?lder, in denen sie sich ?fters schwere Schlappen hatten holen m?ssen. Der Rest verringerte sich unter dem Eigenbedarf der Bev?lkerung in entsprechend gesteigertem Ma?e. In den letzten Jahrzehnten wirkte sich wohl besonders unheilvoll der sich st?ndig steigernde Holzbedarf des emporbl?henden Grosny aus. Es existiert dort ein besonderer Holzmarkt, zu dem allw?chentlich viele Hunderte tschetschenischer Arben[6 - Einheimischer zweir?driger Karren.]) gr?nes, unreifes Holz heranschleppen. Und ?ber die Gesch?ftspraxis der sogenannten Waldh?ter erz?hlt man sich allerlei nicht gerade r?hmenswertes. So sterben eben die tschetschenischen W?lder, wenn nicht bald rigorose Schutzma?nahmen ergriffen werden.
Die obere Waldgrenze liegt ungef?hr bei 1800 m, die H?hen des Kalk- und Schiefergebirges sind daher waldfrei. Kahl sind aber auch die tiefen T?ler. Auch hier waren fr?her W?lder, wie ich von alten Leuten erfahren konnte, und ihr Verschwinden ist ausschlie?lich der Hand des Menschen zuzuschreiben. Etwas weiter dringt der Wald im Fortanga-Gebiet nach S vor, auch an den Oberl?ufen des Scharo- und Tschanti-Argun befinden sich W?lder, jedoch meist nur an den nach N exponierten H?ngen. Hier findet sich auch Nadelwald und zwar ausschlie?lich aus Kiefern fand ich auch an wenigen Stellen im andischen Daghestan. Im h?heren Gebirge tritt auch die Birke auf.
Die H?hen sind mit Almen bedeckt, die sehr frisch und kr?ftig werden k?nnen. Im ?bergangsgebiet sieht man h?ufig Rhododendrengeb?sch. Die obere Grenze der zusammenh?ngenden Grasfl?chen fand ich im Basch-lam ungef?hr bei 3000 m. (?ber die Verh?ltnisse in der Ssunscha-Ebene s. S. 17 f.).
e) Landschafts- und Gaugliederung. Die physiogeographische Beschreibung des Tschetschenengebietes hat bereits die Grundz?ge seiner landschaftlichen Gliederung erkennen lassen. Diese einzelnen Landschaften unterscheiden sich auch recht wesentlich in anthropogeographischer Beziehung voneinander, bilden z. T. Gebiete mit kultureller Sonderstellung, so da? ich sie lieber als Gaue bezeichnen m?chte. Ich gebe hier eine ?bersicht ?ber die tschetschenische Gaugliederung mit kurzer Charakteristik der einzelnen Gaue, soweit sie nicht schon gebracht wurde.
Der Name Itschkerien wurde bereits erw?hnt. Man fa?t darunter das Gebiet der terti?ren Vorberge und des bewaldeten Nordhanges ?stlich des Tschanti-Argun, das besonders durch die zwischen die niedrigen R?cken eingelagerten Schotterebenen und breiten Flu?terrassen gekennzeichnet ist. Ihnen verdankt es auch seinen Namen. Itschkerien ist n?mlich ein Wort kum?kischen d. h. t?rkischen Ursprungs. «Ici Jeri» hei?t w?rtlich «das Land da drinnen», d. h. zwischen den Bergen, das Land, das selbst innerhalb der Berge noch bequem als Ackerland benutzt werden kann. (Laudajew, Lit. Verz. 24). So sind auch hier gerade die wohlhabendsten D?rfer entstanden, wie Itschkerien ?berhaupt das weitaus entwickeltste Gebiet der tschetschenischen Berge darstellt. Auf einer derartigen Ebene liegt auch der Hauptort des Gebietes, das gleichzeitig auch einen besonderen politischen Verwaltungsbezirk bildet, Wedeno. Es ist lange nicht der bedeutendste Ort des Tschetschenengebietes, aber der bekannteste, und das dank der kaukasischen Kriege. Schamil, der daghestanische Freiheitsk?mpfer, dem ja auch die Tschetschenen teils freiwillig, teils unfreiwillig anhingen, hatte hier sein befestiges Lager, das von den Russen gest?rmt werden mu?te, die dann ihrerseits zur besseren Beherrschung des Gaues weitr?umige Festungswerke und Kasernements schufen. Derartige alte Russenfestungen finden sich auch noch an anderen Stellen des Landes; sie fallen stets auf durch die M?chtigkeit ihrer Anlage. Ferner war Wedeno auch einmal die Hauptstadt der Tschetschenen w?hrend ihres kurzen Selbst?ndigkeitstraumes, als ein in seiner Art genialer Tschetschene 1919 hier das sogenannte Nordkaukasische Emirat schuf, das freilich im n?chsten Jahre unter den Schl?gen des Bolschewistensturmes wieder verschwand. Wedeno wird auch als Sommerfrische von denen benutzt, die dem Staub und der Hitze Grosnys entgehen wollen; eine Anzahl von Datschen (Sommerh?usern) dient diesem Zweck.
Abgesehen von den Stra?en- und Haufend?rfern, die man auf diesen Ebenen antrifft, herrscht im ?brigen Itschkerien vielfach Einzelsiedlung. Es sind durchweg schmucke, saubere H?user mit wei? oder bunt get?nchten Mauern und leuchtenden roten Ziegeld?chern, die einen ungemein freundlichen, friedlichen Anblick bieten, wie ?berhaupt die ganze Landschaft Itschkeriens den Zug der Anmut und erquickenden Frische in sich tr?gt.