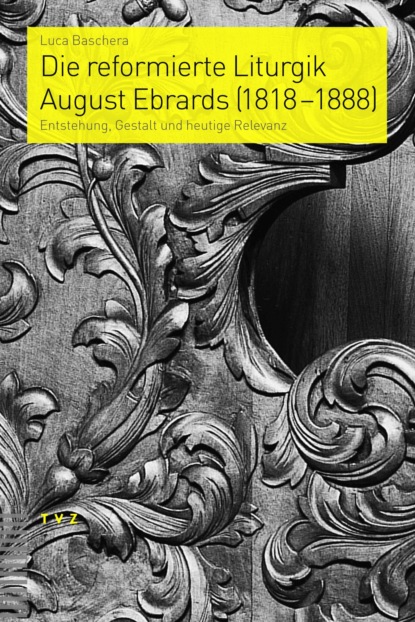
Полная версия:
Die reformierte Liturgik August Ebrards (1818-1888)
Ebrards akademische Karriere kam dennoch zu einem vorzeitigen Ende, als er am 16. März 1853 als Konsistorialrat der seit 1848 von München unabhängig gewordenen unierten Kirche der Pfalz berufen wurde. Wie er später erfahren sollte, war seine Ernennung von der »strenglutherischen Partei« in Bayern angeregt worden, die durch Ebrards Versetzung die Position der Reformierten an der Erlanger Fakultät schwächen wollte.38
Die Vereinigte protestantisch-evangelisch-christliche Kirche der Pfalz war 1818 aus dem Zusammenschluss der reformierten und lutherischen Gemeinden im Gebiet der linksrheinischen Pfalz, das 1816 an Bayern gekommen war,39 entstanden. Anders als in Preußen (1817) kam die Union in der Pfalz allerdings nicht durch einen obrigkeitlichen Beschluss, sondern durch Abstimmung in den Gemeinden zustande. Eine gemeinsame, 1818 in Kaiserslautern tagende Synode hatte zwar die Union formalisiert, aber – im Geist des Rationalismus – auf die Festlegung einer Bekenntnisgrundlage verzichtet.40 Darüber hinaus war die Presbyterialordnung im Zuge der Revolution 1848 in eine – so Ebrard – »kirchliche Ochlokratie«41 verwandelt worden.42 Es ist somit verständlich, dass sich der neugewählte, konfessionsbewusste Konsistorialrat Ebrard nun für eine tiefgreifende, sowohl die Bekenntnisgrundlage als auch die Kirchenverfassung betreffende Reform der pfälzischen Landeskirche einsetzte.
Die erste Aufgabe, die Ebrard nach seiner Ernennung übernahm, war die Abfassung eines neuen Katechismus, dessen Entwurf bereits 1853 von der Generalsynode genehmigt wurde.43 Im selben Jahr gelang es Ebrard, von der Generalsynode die Confessio Augustana Variata44 (1540) – die »urkundlich den Consensus |19| zwischen lutherischer und reformierter Lehre dar[stellt]«45 – als offizielles und verbindliches Glaubensbekenntnis der pfälzischen Landeskirche einführen zu lassen.46 Sowohl die Verfassung eines Unionskatechismus als auch die Einführung eines für die pfälzische Kirche in ihrer Gesamtheit – d. h. für Reformierte und Lutheraner zugleich – geltenden Glaubensbekenntnisses waren in den Augen Ebrards unerlässliche Schritte hin zu einer wahren Union.47 Obwohl einige Pfarrer der Ansicht waren, dass es einem jeden Geistlichen überlassen werden sollte, in seiner Gemeinde im Sinne der lutherischen oder der reformierten Lehre zu predigen, konnten sich diejenigen, welche die Position Ebrards vertraten, letztlich durchsetzen. Auch die Verhandlungen über die Reform der Wahlordnung endeten mit einer Genehmigung des Antrags Ebrards um Wiederherstellung der Regeln von 1818.48 Obwohl Ebrard in diesen Jahren von seinen vielen Verpflichtungen als Konsistorialrat stark in Anspruch genommen wurde, fand er dennoch die nötige Muße, um seine Vorlesungen über Praktische Theologie für den Druck (1854) vorzubereiten.49
Hatte Ebrard bezüglich Katechismus, Bekenntnis und Kirchenverfassung – wie er schreibt – »einen glänzenden Sieg«50 errungen, so scheiterten seine Bemühungen schließlich an der Reform des Gesangbuchs, die von der Generalsynode 1853 ebenfalls in Auftrag gegeben worden war. Bereits 1856 hatte Ebrard zusammen mit seinem Kollegen Friedrich Börsch51 einen Entwurf mit 353 Liedern erarbeitet.52 Der Entwurf wurde in den folgenden zwei Jahren immer wieder überarbeitet und erweitert, sodass die Endfassung 1000 Lieder umfasste.53 Diese wurde von König Maximilian II. – der im Sinne des »Summepiskopats« die Kirchenleitung innehatte – am 2. Juli 1858 genehmigt und lag im April 1859 gedruckt vor.54 Gegen die Einführung des neuen, in der Textwahl »positiv« ausgerichteten Gesangbuchs protestierten zuerst nur rationalistisch gesinnte Gruppen, denen sich dann auch die Kreisregierung anschloss.55 Da aber der König der festen Überzeugung war, dass »sanktionierte Beschlüsse einer Generalsynode« nicht |20| umgestoßen werden dürften,56 blieben die Proteste zunächst erfolglos. Erst ein sich 1860 entzündeter juristischer Streit leitete eine neue Entwicklung ein, die letztlich zur Niederlage der Reformbemühungen Ebrards führen sollte. Zur Debatte stand die Rechtsgültigkeit der Wahlordnungsreform aus dem Jahr 1853. Der von der pfälzischen Generalsynode genehmigte Entwurf war nämlich vom Ministerium in München geringfügig bearbeitet worden und in dieser Form in Kraft getreten, ohne dass offenbar eine explizite Genehmigung der abgeänderten Vorlage durch den König erfolgt war.57 Wurde aber die Gültigkeit der Wahlordnungsreform 1853 angezweifelt, so musste auch diejenige sämtlicher seither erfassten Synodalbeschlüsse in Frage gestellt werden. Dies bewirkte letztlich, dass der König 1861 eigenmächtig nicht nur das neue Gesangbuch, sondern auch den Unionskatechismus abschaffte und kurz darauf die alte Wahlordnung aus dem Jahr 1848 wieder einführte.58 Infolge solcher in Ebrards Augen höchst verwerflichen Entwicklungen sah er sich gezwungen, sein Amt niederzulegen.59
Ebrard erhielt seinen Abschied am 20. April 1861 und kehrte nach Erlangen zurück, konnte aber seine Professur nicht wieder antreten, denn in der Person von Johann Jakob Herzog60 (1805–1882) war sein Nachfolger bereits gewählt worden. Ab 1862 wurde ihm dennoch gestattet, an der Universität als Emeritus Vorlesungen zu halten.61 Im folgenden Jahrzehnt widmete er sich einer regen publizistischen Tätigkeit. Neben einer zweibändigen Apologetik (1874/75), einem vierbändigen Handbuch der christlichen Kirchen- und Dogmengeschichte (1865/66) und zahreichen Aufsätzen veröffentlichte Ebrard auch sieben Romane sowie Abhandlungen über Akustik und Farbenlehre.62 Im Alter von 57 Jahren wurde er zuletzt – wie sein Vater etliche Jahrzehnte zuvor – Pfarrer der französisch-reformierten Gemeinde in Erlangen, ein Amt, das er bis an sein Lebensende 1888 bekleidete.
Angesichts der erstaunlichen Produktivität Ebrards als Publizist ist es bemerkenswert, dass er bald nach seinem Ableben in fast vollkommene Vergessenheit geriet. Karl Eduard Haas vermutet, dass dies einerseits durch die fehlende Gründlichkeit einiger seiner Schriften bedingt sei – man denke vor allem an seine |21| Streitschriften gegen Schweizer –, andererseits aber auch durch seinen polemischen Eifer, der ihn sehr unbeliebt machte.63
2. Theologisches Profil
Martin Kähler rechnet Ebrard zusammen etwa mit August Neander, Carl Immanuel Nitzsch und Julius Müller der Gruppe »kirchlich-pietistischer Vermittlungstheologen« zu, die eine »Verbindung zwischen Christentum und Bildung« dadurch anstrebten, »daß die Bildung durch das Christentum bestimmt wird, also durch Christianisierung der Bildung«.64 Das Urteil Kählers wird von Ebrard selbst bekräftigt, der gerade die Arbeiten Nitzschs und Müllers als Früchte des »Wiedererwachens des Glaubens« in seinem Jahrhundert und als Beispiele »gläubiger Theologie« betrachtet.65 Die Nähe Ebrards zur Erweckungstheologie – deren Vertreter sowohl Neander als auch Müller waren66 – wird darüber hinaus dadurch bestätigt, dass Ebrard beide Hauptanliegen dieser theologischen Ausrichtung teilte: einerseits den Kampf gegen die »liberale« oder »freie Theologie« eines Strauß oder Biedermann, andererseits die Abwehr stur konfessionalistischer Positionen wie jener der neulutherischen restaurativen Theologie.67
Ebrards Absage an den Konfessionalismus wird in der Vorrede zum zweiten Band seiner »Christlichen Dogmatik« deutlich formuliert: »Ein anderes ist der Glauben in Christum, ein anderes der Glauben oder richtiger die Ueberzeugung von der Richtigkeit eines Dogma’s oder Bekenntnisses. […] Der erstere soll felsenfest und über jeden Zweifel erhaben sein; die letztere muß auf Grund des ersteren fort und fort neu an der h[eiligen] Schrift geprüft werden, da weder die Väter noch ich selber infallibel waren.«68 Wehrt sich Ebrard gegen eine konfessionalistische Haltung, die letztlich »die h[eilige] Schrift unter die Autorität der Bekenntnißschriften erniedrigt«,69 so versteht er seine Theologie gerade deshalb als »eine ächt reformierte«.70 In Ebrards Selbstverständnis steht er somit in Kontinuität einerseits zu reformierten »biblischen Theologen« wie Johannes Cocceius (1603–1669) oder Frans Burman (1628–1679),71 andererseits zur »deutsch-reformierten« |22| Tradition.72 Letztere versteht Ebrard als eine Synthese zwischen dem Erbe Melanchthons und jenem Calvins, wobei von Melanchthon die Ablehnung der Lehre der absoluten Prädestination, von Calvin das Abendmahlsverständnis übernommen worden sei. Auf diese Weise – nämlich durch das Zusammentreffen von »verstandenmäßiger romanischer Schärfe« und »deutscher Gemüthstiefe«73 – sei eine Form von reformierter Theologie entstanden, die wegen ihrer Überwindung des calvinischen Prädestinationsdogmas immer schon für eine Union mit den lutherischen Kirchen offen gewesen sei.74
Ist Ebrards Charakterisierung der deutschen reformierten Tradition historisch fragwürdig,75 so kommt dabei doch ein wesentlicher Zug seiner eigenen Theologie deutlich zum Ausdruck, und zwar seine tiefe Abneigung gegen das orthodox reformierte Prädestinationsdogma. Diese Abneigung verleitete ihn bisweilen sogar zu schier unhaltbaren Behauptungen. So beteuerte er etwa in Polemik zu Alexander Schweizer – der die Prädestinationslehre als »Centraldogma« der reformierten Theologie definiert hatte –, dass »zwei Drittheile der reformirten Kirche […] von der Schiefheit der absoluten Prädestinationslehre in dieser (grundlegenden) Periode [d. h. der reformierten Orthodoxie] völlig frei« gewesen und »nur das dritte Drittheil, die calvinisch-reformierte Kirche im engern Sinn, davon influirt« worden sei.76 Für Schweizer war es wohl leicht, die Unhaltbarkeit solcher Aussagen historisch nachzuweisen.77 Einerseits trifft also zu, was Ernst Friedrich Karl Müller bereits Ende des neunzehnten Jahrhunderts zu Ebrard anmerkte: Dieser habe oft »die nüchterne Forschung hinter den eignen Empfindungen |23| zurücktreten lassen«.78 Gleichzeitig muss aber auch bedacht werden, dass Ebrards Hauptinteresse – anders als das Schweizers – nicht bei der Wiedergabe historischer Tatsachen lag. Vielmehr strebte er eine »organische Weiterentwicklung« der reformierten Dogmatik in ökumenischer Weite an.79 Es wäre jedenfalls für eine positivere Rezeption seines Anliegens förderlich gewesen, wenn er darauf verzichtet hätte, seine Position in der Geschichte der orthodox reformierten Theologie zu verankern zu suchen, und an der nüchternen – und ehrlicheren – Feststellung festgehalten hätte, er sei »in der Prädestinationslehre entschiedener Gegner Calvin’s und Anhänger Melanchthon’s«.80
Aus welchen Gründen lehnte aber Ebrard die Prädestinationslehre so dezidiert ab? Einerseits meinte er einen Zusammenhang zwischen orthodox reformiertem Determinismus und den pantheistischen Tendenzen in der Theologie Schleiermachers und, vor allem, Schweizers zu erkennen.81 Andererseits war die klassische Prädestinationslehre unvereinbar mit Ebrards starker Betonung der Willensfreiheit im Rahmen seiner Wiedergeburtslehre – die Jacobs zufolge als der »innerste Kreis seines theologischen Denkens« anzusehen ist.82
Die Wiedergeburt wird von Ebrard als Moment eines subjektiven und zugleich kosmischen Prozesses betrachtet, den er als »Verklärung« bezeichnet. Der Mensch sei zur »Verklärung in Gott« bestimmt83 und diese entfalte sich in den drei Hauptmomenten der Heilsgeschichte, nämlich der »Heilsanlage« (»Erschaffung des Menschen und seine Bestimmung zur Verklärung Gottes in ihm«), der »Heilsbegründung« (die »Erlösungsthatsache, Christus und sein Werk«) und der »Heilsaneignung« (»Erreichung der Bestimmung durch Annahme der dargebotenen Erlösung«).84 Der Verklärung des Menschen in Gott liege aber eine Verklärung Gottes selbst zugrunde. Diese umfasse drei Momente, die den drei trinitarischen Personen entsprechen. Die Heilsanlage gründe in der Schöpfungstat Gottes des Vaters, der »Verklärung Gottes als des Ursprungs alles Zeitlichen«; die Heilsbegründung gehe auf die Menschwerdung des Sohnes, die »Verklärung Gottes in der Zeit«, zurück; die Heilsaneignung habe schließlich ihren Ursprung im Wirken des Heiligen Geistes, der »Verklärung Gottes als des Vollenders«.85
|24| Obwohl der erste Schritt hin zur Heilsaneignung in der Bekehrung (metanoia) besteht, d. h. in einer »Wandlung der Gedanken und Gesinnungen«,86 so bildet doch die Wiedergeburt (anagennesis) das entscheidende Heilsereignis. Diese wird als Umwandlung des »substantiellen Lebenscentrums« im Menschen definiert, die durch Christus bewirkt wird, »damit von diesem Centrum uns nicht eine neue physis allein, noch eine neue Gesinnung allein, sondern ein ganzer neuer Mensch sich bilde, der sofort nach beiden Seiten sich weiterentwickle«.87 Christus sei aber nicht bloß Ursache oder Grund der Wiedergeburt, sondern teile sich in dieser real dem Menschen mit.88 In Anlehnung an seinen amerikanischen Zeitgenossen John Williamson Nevin89 konzipiert Ebrard diese Selbstmitteilung Christi – auch unio mystica genannt90 – als eine Vereinigung seines »Lebenscentrums« mit dem menschlichen, die in einer tiefen Gemeinschaft resultiere, ohne dass dabei das menschliche Sein durch das Sein Christi ersetzt werde.91 Vielmehr werde die »seelische Substanz« des Menschen von der aus Christus herausströmenden »lebengebenden Kraft« neu geboren, sodass er sich wieder Gott als »realem Quell seines Lebens« zuwenden kann.92
Obwohl die anagennesis als eher passives Moment betrachtet wird,93 wirken Ebrard zufolge bei ihr wie bei der metanoia Gott und der menschliche Wille mit, wobei Letzterer immer im Stande ist, die ihm bloß »dargebotene Erlösung« abzulehnen bzw. nach deren Erwerb zu verlieren: Entgegen der augustinischen Position ist die gratia für Ebrard somit immer resistibilis.94 Diese Betonung der Willensfreiheit in jeder Phase der Heilsaneignung führte aber dazu, dass sich Ebrard in mehrfacher Hinsicht vom reformatorischen Konsens entfernte und letztlich »in die Gefahrzone des Pelagianismus« begab.95 So deutet er etwa die Wirkung des Heiligen Geistes bei der Bekehrung als Wiederherstellung der Willensfreiheit, wobei Letztere deutlich – und in expliziter Anlehnung an die Remonstranten96 – |25| als libertas indifferentiae, als Freiheit, die Gnade anzunehmen oder abzulehnen, aufgefasst wird.97 Ferner sei der Mensch, obwohl er sich nur »rezeptiv« zum die Wiedergeburt herbeiführenden Heiligen Geist verhält, nach erfolgter Wiedergeburt dazu berufen, als »neuer« Mensch im Kampf gegen den »alten« Menschen mit der Gnade mitzuwirken. Hier wendet sich Ebrard in zweierlei Hinsicht vom reformatorischen Konsens ab.
Erstens betont er, dass die Wiedergeburt eine reale »Umschaffung« des Menschen bedeute, sodass dieser nun »im Centrum seines Wesens« gut sei und nur in der »Peripherie« fleischlich bleibe.98 Somit leugnet er einen zentralen Aspekt reformatorischer Theologie, nämlich die Idee, dass der erwählte Christ ganz Sünder bleibe, was herkömmlich in der Formel simul iustus et peccator zusammengefasst wird. Diese Ansicht wurde hingegen von Römisch-Katholiken, Remonstranten und Sozinianern bestritten. Die Kontinuität zwischen Ebrards Position und der remonstrantischen bzw. sozinianischen wird des Weiteren durch seine Interpretation von Röm 7 bestätigt. Passagen wie: »Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich« (Röm 7,19), die eine Überwindung der Sünde im Wiedergeborenen in Frage stellen, interpretiert Ebrard – wie die Sozinianer und Remonstranten es auch schon taten99 – als Aussagen über den Zustand des Paulus vor seiner Bekehrung.100
Zweitens hält Ebrard daran fest, dass dieser in seinem »Lebenscentrum« gerecht gewordene Mensch trotzdem vom Heil gänzlich abfallen kann, wenn er »im Kampfe gegen den alten Menschen träge wird«.101 Auch hier wird ein zentraler Aspekt reformatorischer Theologie – die Lehre der perseverantia sanctorum – zugunsten der Position der Remonstranten abgelehnt.102
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ebrard in seiner Soteriologie den Boden reformatorischer Theologie weitgehend verlassen und die »Gefahrzone des Pelagianismus« nicht nur gestreift, sondern tatsächlich betreten hat. Die ganze Heilsaneignung, von ihrem Beginn bei der metanoia bis zu ihrer Vollendung, hängt bei ihm von einer Entscheidung bzw. der Beständigkeit des Menschen ab. |26| Während die Reformatoren einerseits die Unwürdigkeit des Menschen vor und nach der Bekehrung, andererseits die Treue Gottes zu seinem Gnadenbund trotz der menschlichen Untreue betonten, macht Ebrard vielmehr den Menschen verantwortlich sowohl für die Annahme als auch für die Bewahrung der Gnade.
Die Zentralität der Wiedergeburtslehre für Ebrards Theologie kann als weitere Bestätigung des großen Einflusses gelten, den die Erweckungsbewegung – vor allem durch seinen Lehrer Johann Christian Krafft – auf ihn ausübte. Ob dieser Einfluss auch seine Liturgik prägte, wird sich im Folgenden zeigen.
|27|
2 Ebrards liturgisches und liturgiewissenschaftliches Werk
1. »Versuch einer Liturgik vom Standpunkte der reformierten Kirche« (1843)
Seine erste liturgiewissenschaftliche Schrift veröffentlichte Ebrard mit 25 Jahren. Diese stellte das Resultat – wie Ebrard in der Vorrede erklärt – »fortgesetzter liturgischer Studien«103 dar und war ursprünglich nur zum eigenen Gebrauch bestimmt, »zur Fixirung eigener Ueberzeugung« sowie »zur Grundlage fernerer Studien«.104 Erst die Kunde, die schweizerischen Kirchen planten gerade eine Revision ihrer Liturgien, habe ihn dazu veranlasst, seine Überlegungen drucken zu lassen.105 Jede Reform sollte immer von klaren Prinzipien geleitet werden, damit sie keine bloße Veränderung des Bestehenden oder gar eine Verschlechterung bewirke, sondern eine wirkliche Verbesserung mit sich bringen könne. Gerade zu einer solchen Reflexion auf die Prinzipien reformierter Liturgik will Ebrard im Versuch beitragen: »Dies Schriftchen ist ein Versuch, die Liturgik der reformierten Kirche prinzipiell und wissenschaftlich zu erbauen.«106 Ebrard will also eine »Theorie des Cultus« vorlegen, die von Anfang an ein klares konfessionelles Profil haben soll. Darin unterscheidet sich sein Entwurf von anderen liturgiewissenschaftlichen Schriften evangelischer Autoren, die im Titel als Theorien des »christlichen« oder »evangelischen« Gottesdienstes im Allgemeinen präsentiert werden,107 deren Inhalt die konfessionelle – lutherische – Zugehörigkeit der Verfasser jedoch rasch deutlich werden lässt. Die Bewahrung der reformierten Identität in liturgischen Belangen war Ebrard umso wichtiger in einer Zeit, in der das Projekt einer Union beider reformatorischer Konfessionen immer häufiger diskutiert werde und besonders unter Reformierten das »Streben« vorhanden sei, »den seit den Zeiten der Verstandesreligion allzu nüchtern gewordenen Cultus wieder zu bereichern«.108 Dabei bestehe aber die Gefahr, dass die Reformierten in liturgicis allzu schnell |28| »die lutherische Observanz« aufnähmen oder gar romanisierende Tendenzen entwickelten.109
Dagegen wollte Ebrard den reformierten und insbesondere – wie er schreibt – den schweizerischen reformierten Kirchen die Notwendigkeit nahelegen, an ihrer eigenen liturgischen Tradition festzuhalten. Der Versuch einer Liturgik stelle somit in erster Linie eine »Besprechung des reformirten Cultus auf reformirtem Boden« dar und gehöre »zu den inneren Verhandlungen auf dem Gebiete der reformirten theologischen Literatur«. Da aber seine Schrift auch wissenschaftliche Qualität besitze, erhoffte sich Ebrard, dass sie auch über die konfessionellen Grenzen hinweg rezipiert und diskutiert würde. Eine solche offene Diskussion hätte schließlich auch positive Auswirkungen für die erstrebte Union, denn nur eine wissenschaftliche Betrachtung der reformierten Liturgik im Vergleich mit der lutherischen könnte künftig die Formulierung allgemeiner Prinzipien für die »praktische Construction eines gemeinsamen [d. h. unierten] Cultus« ermöglichen.110
Der Versuch einer Liturgik gliedert sich in zwölf Kapitel und 131 fortlaufend nummerierte Paragraphen, wobei die ersten sechs Kapitel die Elemente und Prinzipien des reformierten Gottesdienstes diskutieren, während die restlichen die Zusammenfügung jener Elemente in verschiedenen Gottesdienstformen besprechen. Eine »musikalische Beilage«, die drei Psalmen (51, 140, 66) in vierstimmigem Satz enthält, sollte den Leser von den Vorzügen des vierstimmigen Gemeindegesangs überzeugen.111
Im Versuch werden zwar die Struktur und die Elemente verschiedener Gottesdiensttypen eingehend besprochen, diese Schrift enthält aber keine Formulare im engeren Sinne. Ebrard weist auf die Vorzüglichkeit der alten, aus der Reformationszeit stammenden Liturgien hin, die mit ihrem »kräftigen, gesunden, ernsten, ebenso gemüthvollen als klaren, und doch weder trockenen noch empfindelnden« Charakter nach wie vor als Muster für die Erarbeitung neuer Formulare gelten sollten. Zugleich formuliert er die Absicht, bald »eine Sammlung alter Formulare, nach den in dieser Schrift niedergelegten Grundsätzen, geordnet und zusammengestellt und verarbeitet« zu veröffentlichen.112 Dieses Vorhaben wird er vier Jahre später durch die Herausgabe des Reformirten Kirchenbuches verwirklichen, das somit auch als Begleitband zum Versuch einer Liturgik betrachtet werden kann. |29|
2. »Reformirtes Kirchenbuch« (1847)
Das Reformirte Kirchenbuch erschien in Zürich im Jahr 1847, kurz bevor der Herausgeber die Stadt und deren Universität verließ. Der Untertitel gibt nähere Auskunft über Charakter und Zweck des Werks: »Vollständige Sammlung der in der reformirten Kirche eingeführten Kirchengebete und Formulare zum praktischen Gebrauche eingerichtet«.113 Durch die Herausgabe dieser Sammlung von Kirchengebeten aus der reformierten Tradition verfolgte Ebrard also in erster Linie einen praktischen Zweck. Wie er in der Einleitung zu diesem Band schreibt, seien die meisten zeitgenössischen reformierten Agenden zu knapp gehalten und deshalb der Ergänzung bedürftig.114 Anstatt neue Gebete zu entwerfen oder sie gar den Liturgien anderer Konfessionen zu entlehnen, hält es Ebrard für sinnvoller, die eigene liturgische Tradition in ihrer Vielfalt wieder zu entdecken und ihre Elemente so miteinander zu kombinieren, dass ein den Bedürfnissen der Zeit genügendes Ganzes entstehe. Durch eine solche Reflexion auf die eigene Tradition sollte darüber hinaus eine »organische Weiterbildung und reichere Entwicklung des [reformierten] Cultus« ermöglicht werden. Damit wollte er keineswegs den reformierten Gottesdienst der »Kahlheit« bezichtigen, wie viele es schon damals taten; er erkennt aber trotzdem an, dass die reformierte Liturgie in mancherlei Hinsicht – wie beispielsweise in Bezug auf das Kirchenjahr – »arm geblieben« sei.115 Die vorliegende Sammlung könne insofern der Bereicherung des reformierten Gottesdienstes dienen, als sie zu einer »konsequenten Entfaltung der in der ref[ormierten] Kirche gegebenen Elemente« führe.116
Ebrard äußert die Hoffnung, dass seine Sammlung nicht nur zur Bereicherung des Gottesdienstes in den deutschen reformierten Diasporagemeinden diene, sondern auch in den reformierten Landeskirchen – wobei er wohl an die Deutschschweiz denkt – aufgenommen oder sogar offiziell eingeführt werde. Er ist überzeugt, dass selbst wenn dies nicht geschehe, sich das Kirchenbuch als ein |30| nützliches Hilfsmittel bei der Durchführung von etwaigen Liturgiereformen in den besagten Landeskirchen bewähren werde.117
Ebrard war allerdings nicht nur auf diesen praktischen Zweck bedacht gewesen, als er die Erarbeitung des Kirchenbuches in Angriff nahm. Dieser Sammlung maß er vielmehr auch eine »theoretisch-wissenschaftliche Bedeutung« bei. Denn anhand der Liturgie, die in einer Kirche gebräuchlich ist, lasse sich feststellen, woran jene Kirche in Wirklichkeit glaube.
Die Liturgie giebt […] das sicherste Maaß ab, welche in den Bekenntnißschriften festgestellten Lehrpunkte wirklich kirchlich-wichtig, und welche nur theologisch bedeutend sind; und gerade jetzt […] dürfte es nicht am unrechten Orte sein, einmal auf diesen Gedanken, auf die Liturgie als auf ein Kriterium, worin das kirchliche Bekenntniß vom kirchlichen Leben gerichtet und gewogen wird, hinzuweisen.118
Eine genaue Studie der reformierten Liturgien durch die Jahrhunderte hindurch lasse darüber hinaus Entwicklungen wie auch »Deformationen« in der Lehre erkennen, sodass zur »symbolischen Wichtigkeit« einer solchen Studie auch eine »kirchenhistorische« hinzutrete.119
Um beiden Anliegen gerecht zu werden – dem praktischen und dem wissenschaftlichen – habe er in erster Linie auf alte Agenden zurückgegriffen, die in einer Bibliographie aufgelistet und genau beschrieben werden.120



