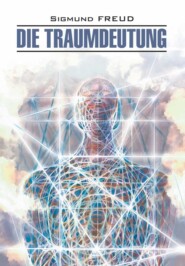скачать книгу бесплатно
Von den Autoren, die im allgemeinen so ungünstig über die psychischen Leistungen im Traume urteilen, wird indes zugegeben, daß ein gewisser Rest von seelischer Tätigkeit dem Traume verbleibt. Wundt, dessen Lehren für so viel andere Bearbeiter der Traumprobleme maßgebend geworden sind, gesteht dies ausdrücklich zu. Man könnte nach der Art und Beschaffenheit des im Traume sich äußernden Restes von normaler Seelentätigkeit fragen. Es wird nun ziemlich allgemein zugegeben, daß die Reproduktionsfähigkeit, das Gedächtnis im Traume am wenigsten gelitten zu haben scheint, ja eine gewisse Überlegenheit gegen die gleiche Funktion des Wachens (vgl. oben p. 8 ff.) aufweisen kann, obwohl ein Teil der Absurditäten des Traumes durch die Vergeßlichkeit eben dieses Traumlebens erklärt werden soll. Nach Spitta ist es das Gemütsleben der Seele, was vom Schlafe nicht befallen wird und dann den Traum dirigiert. Als »Gemüt« bezeichnet er »die konstante Zusammenfassung der Gefühle als des innersten subjektiven Wesens des Menschen« (p. 84).
Scholz (p. 37) erblickt eine der im Traume sich äußernden Seelentätigkeiten in der »allegorisierenden Umdeutung«, welcher das Traummaterial unterzogen wird. Siebeck konstatiert auch im Traume die »ergänzende Deutungstätigkeit« der Seele (p. 11), welche von ihr gegen alles Wahrnehmen und Anschauen geübt wird. Eine besondere Schwierigkeit hat es für den Traum mit der Beurteilung der angeblich höchsten psychischen Funktion, der des Bewußtseins. Da wir vom Traume nur durchs Bewußtsein etwas wissen, kann an dessen Erhaltung kein Zweifel sein; doch meint Spitta, es sei im Traume nur das Bewußtsein erhalten, nicht auch das Selbstbewußtsein. Delboeuf gesteht ein, daß er diese Unterscheidung nicht zu begreifen vermag.
Die Assoziationsgesetze, nach denen sich die Vorstellungen verknüpfen, gelten auch für die Traumbilder, ja ihre Herkunft kommt im Traume reiner und stärker zum Ausdruck. Strümpell (p. 70): »Der Traum verläuft entweder ausschließlich, wie es scheint, nach den Gesetzen nackter Vorstellungen oder organischer Reize mit solchen Vorstellungen, das heißt, ohne daß Reflexion und Verstand, ästhetischer Geschmack und sittliches Urteil etwas dabei vermögen.« Die Autoren, deren Ansichten ich hier reproduziere, stellen sich die Bildung der Träume etwa folgender Art vor: Die Summe der im Schlafe einwirkenden Sensationsreize aus den verschiedenen an anderer Stelle angeführten Quellen wecken in der Seele zunächst eine Anzahl von Vorstellungen, die sich als Halluzinationen (nach Wundt richtiger Illusionen wegen ihrer Abkunft von den äußeren und inneren Reizen) darstellen. Diese verknüpfen sich untereinander nach den bekannten Assoziationsgesetzen und rufen ihrerseits nach denselben Regeln eine neue Reihe von Vorstellungen (Bildern) wach. Das ganze Material wird dann vom noch tätigen Reste der ordnenden und denkenden Seelenvermögen, so gut es eben gehen will, verarbeitet (vgl. etwa Wundt und Weygandt). Es ist bloß noch nicht gelungen, die Motive einzusehen, welche darüber entscheiden, daß die Erweckung der nicht von außen stammenden Bilder nach diesem oder nach jenem Assoziationsgesetz vor sich gehe.
Es ist aber wiederholt bemerkt worden, daß die Assoziationen, welche die Traumvorstellungen untereinander verbinden, von ganz besonderer Art und verschieden von den im wachen Denken tätigen sind. So sagt Volkelt (p. 15): »Im Traume jagen und haschen sich die Vorstellungen nach zufälligen Ähnlichkeiten und kaum wahrnehmbaren Zusammenhängen. Alle Träume sind von solchen nachlässigen, zwanglosen Assoziationen durchzogen.« Maury legt auf diesen Charakter der Vorstellungsbindung, der ihm gestattet, das Traumleben in engere Analogie mit gewissen Geistesstörungen zu bringen, den größten Wert. Er anerkennt zwei Hauptcharaktere des »délire«: 1. une action spontanée et comme automatique de l‘esprit; 2. une association vicieuse et irregulière des idées (p. 126). Von Maury selbst rühren zwei ausgezeichnete Traumbeispiele her, in denen der bloße Gleichklang der Worte die Verknüpfung der Traumvorstellungen vermittelt. Er träumte einmal, daß er eine Pilgerfahrt (pélerinage) nach Jerusalem oder Mekka unternehme, dann befand er sich nach vielen Abenteuern beim Chemiker Pelletier, dieser gab ihm nach einem Gespräche eine Schaufel (pelle) von Zink und diese wurde in einem darauffolgenden Traumstück sein großes Schlachtschwert (p. 137). Ein andermal ging er im Traume auf der Landstraße und las auf den Meilensteinen die Kilometer ab, darauf befand er sich bei einem Gewürzkrämer, der eine große Wage hatte, und ein Mann legte Kilogewichte auf die Wagschale, um Maury abzuwägen; dann sagte ihm der Gewürzkrämer: »Sie sind nicht in Paris, sondern auf der Insel Gilolo.« Es folgten darauf mehrere Bilder, in welchen er die Blume Lobelia sah, dann den General Lopez, von dessen Tod er kurz vorher gelesen hatte; endlich erwachte er, eine Partie Lotto spielend[16 - An späterer Stelle wird uns der Sinn solcher Träume, die von Worten mit gleichen Anfangsbuchstaben und ähnlichem Anlaute erfüllt sind, zugänglich werden.].
Wir sind aber wohl gefaßt darauf, daß diese Geringschätzung der psychischen Leistungen des Traumes nicht ohne Widerspruch von anderer Seite geblieben ist. Zwar scheint der Widerspruch hier schwierig. Es will auch nicht viel bedeuten, wenn einer der Herabsetzer des Traumlebens versichert (Spitta, p. 118), daß dieselben psychologischen Gesetze, die im Wachen herrschen, auch den Traum regieren, oder wenn ein anderer (Dugas) ausspricht: Le rêve n‘est pas déraison ni même irraison pure, solange beide sich nicht die Mühe nehmen, diese Schätzung mit der von ihnen beschriebenen psychischen Anarchie und Auflösung aller Funktionen im Traume in Einklang zu bringen. Aber anderen scheint die Möglichkeit gedämmert zu haben, daß der Wahnsinn des Traumes vielleicht doch nicht ohne Methode sei, vielleicht nur Verstellung wie der des Dänenprinzen, auf dessen Wahnsinn sich das hier zitierte einsichtsvolle Urteil bezieht. Diese Autoren müssen es vermieden haben, nach dem Anschein zu urteilen, oder der Anschein, den der Traum ihnen bot, war ein anderer.
So würdigt Havelock Ellis (1899) den Traum, ohne bei seiner scheinbaren Absurdität verweilen zu wollen, als »an archaïc world of vast emotions and imperfect thoughts«, deren Studium uns primitive Entwicklungsstufen des psychischen Lebens kennen lehren könnte. J. Sully (p. 362) vertritt dieselbe Auffassung des Traumes in einer noch weiter ausgreifenden und tiefer eindringenden Weise. Seine Aussprüche verdienen um so mehr Beachtung, wenn wir hinzunehmen, daß er wie vielleicht kein anderer Psychologe von der verhüllten Sinnigkeit des Traumes überzeugt war. »Now our dreams are a means of conserving these successive personalities. When asleep we go back to the old ways of looking at things and of feeling about them, to impulses and activities which long ago dominated us.« Ein Denker wie Delboeuf behauptet – freilich ohne den Beweis gegen das widersprechende Material zu führen und darum eigentlich mit Unrecht: »Dans le sommeil, hormis la perception, toutes les facultés de l‘esprit, intelligence, imagination, mémoire, volonté, moralité, restent intactes dans leur essence; seulement, elles s‘appliquent à des objets imaginaires et mobiles. Le songeur est un acteur qui joue à volonté les fous et les sages, les bourreaux et les victimes, les nains et les géants, les démons et les anges« (p. 222). Am energischesten scheint die Herabsetzung der psychischen Leistung im Traume der Marquis d‘Hervey bestritten zu haben, gegen den Maury lebhaft polemisiert und dessen Schrift ich mir trotz aller Bemühung nicht verschaffen konnte. Maury sagt über ihn (p. 19): »M. le Marquis d‘Hervey prête à l‘intelligence, durant le sommeil, toute sa liberté d‘action et d‘attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans l‘occlusion des sens, dans leur fermeture au Monde extérieur; en sorte que l‘homme qui dort ne se distingue guère, selon sa manière de voir, de l‘homme qui laisse vaguer sa pensée en se bouchant les sens; toute la différence qui sépare alors la pensée ordinaire de celle du dormeur c‘est que, chez celui, l‘idée prend une forme visible, objective et ressemble, à s‘y méprendre, à la sensation déterminée par les objets extérieurs; le souvenir revêt l‘apparence du fait présent.«
Maury fügt aber hinzu: »qu’il y a une différence de plus et capitale à savoir que les facultés intellectuelles de l’homme endormi n’offrent pas l’équilibre qu’elles gardent chez l’homme éveillé.«
Bei Vaschide, der uns eine bessere Kenntnis des Buches von d‘Hervey vermittelt, finden wir, daß sich dieser Autor in folgender Art über die scheinbare Inkohärenz der Träume äußert. »L‘image du rêve est la copie de l‘idée. Le principal est l’idée; la vision n’est qu’accessoire. Ceci établi, il faut savoir suivre la marche des idées, il faut savoir analyser le tissu des rêves; l’incohérence devient alors compréhensible, les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfectement logiques«. (p. 146.) Und (p. 147): »Les rêves les plus bizarres trouvent même une explication des plus logiques quand on sait les analyser.«
J. Stärcke hat darauf aufmerksam gemacht, daß eine ähnliche Auflösung der Trauminkohärenz von einem alten Autor, Wolf Davidson, der mir unbekannt war, 1799 verteidigt worden ist (p. 136): »Die sonderbaren Sprünge unserer Vorstellungen im Traume haben alle ihren Grund in dem Gesetze der Assoziation, nur daß diese Verbindung manchmal sehr dunkel in der Seele vorgeht, so daß wir oft einen Sprung der Vorstellung zu beobachten glauben, wo doch keiner ist.«
Die Skala der Würdigung des Traumes als psychisches Produkt hat in der Literatur einen großen Umfang; sie reicht von der tiefsten Geringschätzung, deren Ausdruck wir kennen gelernt haben, durch die Ahnung eines noch nicht enthüllten Wertes bis zur Überschätzung, die den Traum weit über die Leistungen des Wachlebens stellt. Hildebrandt, der, wie wir wissen, in drei Antinomien die psychologische Charakteristik des Traumlebens entwirft, faßt im dritten dieser Gegensätze die Endpunkte dieser Reihe zusammen (p. 19): »Es ist der zwischen einer Steigerung, einer nicht selten bis zur Virtuosität sich erhebenden Potenzierung und anderseits einer entschiedenen, oft bis unter das Niveau des Menschlichen führenden Herabminderung und Schwächung des Seelenlebens.«
»Was das erstere betrifft, wer könnte nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, daß in dem Schaffen und Weben des Traumgenius bisweilen eine Tiefe und Innigkeit des Gemütes, eine Zartheit der Empfindung, eine Klarheit der Anschauung, eine Feinheit der Beobachtung, eine Schlagfertigkeit des Witzes zu Tage tritt, wie wir solches alles als konstantes Eigentum während des wachen Lebens zu besitzen bescheidentlich in Abrede stellen würden? Der Traum hat eine wunderbare Poesie, eine treffliche Allegorie, einen unvergleichlichen Humor, eine köstliche Ironie. Er schauet die Welt in einem eigentümlichen idealisierenden Lichte und potenziert den Effekt ihrer Erscheinungen oft im sinnigsten Verständnisse des ihnen zum Grunde liegenden Wesens. Er stellt uns das irdisch Schöne in wahrhaft himmlischem Glanze, das Erhabene in höchster Majestät, das erfahrungsgemäß Furchtbare in der grauenvollsten Gestalt, das Lächerliche mit unbeschreiblich drastischer Komik vor Augen; und bisweilen sind wir nach dem Erwachen irgend eines dieser Eindrücke noch so voll, daß es uns vorkommen will, dergleichen habe die wirkliche Welt uns noch nie und niemals geboten.«
Man darf sich fragen, ist es wirklich das nämliche Objekt, dem jene geringschätzigen Bemerkungen und diese begeisterte Anpreisung gilt? Haben die einen die blödsinnigen Träume, die anderen die tiefsinnigen und feinsinnigen übersehen? Und wenn beiderlei vorkommt, Träume, die solche und die jene Beurteilung verdienen, scheint es da nicht müßig, nach einer psychologischen Charakteristik des Traumes zu suchen, genügt es nicht zu sagen, im Traume sei alles möglich, von der tiefsten Herabsetzung des Seelenlebens bis zu einer im Wachen ungewohnten Steigerung desselben? So bequem diese Lösung wäre, sie hat dies eine gegen sich, daß den Bestrebungen aller Traumforscher die Voraussetzung zu grunde zu liegen scheint, es gäbe eine solche in ihren wesentlichen Zügen allgemeingültige Charakteristik des Traumes, welche über jene Widersprüche hinweghelfen müßte.
Es ist unstreitig, daß die psychischen Leistungen des Traumes bereitwilligere und wärmere Anerkennung gefunden haben in jener jetzt hinter uns liegenden intellektuellen Periode, da die Philosophie und nicht die exakten Naturwissenschaften die Geister beherrschte. Aussprüche wie die von Schubert, daß der Traum eine Befreiung des Geistes von der Gewalt der äußeren Natur sei, eine Loslösung der Seele von den Fesseln der Sinnlichkeit, und ähnliche Urteile von dem jüngeren Fichte[17 - Vgl. Haffner und Spitta.] u. a., welche sämtlich den Traum als einen Aufschwung des Seelenlebens zu einer höheren Stufe darstellen, erscheinen uns heute kaum begreiflich; sie werden in der Gegenwart auch nur bei Mystikern und Frömmlern wiederholt[18 - Der geistreiche Mystiker Du Prel, einer der wenigen Autoren, denen ich die Vernachlässigung in früheren Auflagen dieses Buches abbitten möchte, äußert, nicht das Wachen, sondern der Traum sei die Pforte zur Metaphysik, soweit sie den Menschen betrifft (Philosophie der Mystik, p. 59).]. Mit dem Eindringen naturwissenschaftlicher Denkweise ist eine Reaktion in der Würdigung des Traumes einhergegangen. Gerade die ärztlichen Autoren sind am ehesten geneigt, die psychische Tätigkeit im Traume für geringfügig und wertlos anzuschlagen, während Philosophen und nicht zünftige Beobachter – Amateurpsychologen —, deren Beiträge gerade auf diesem Gebiete nicht zu vernachlässigen sind, im besseren Einvernehmen mit den Ahnungen des Volkes, meist an dem psychischen Werte der Träume festgehalten haben. Wer zur Geringschätzung der psychischen Leistung im Traume neigt, der bevorzugt begreiflicherweise in der Traumätiologie die somatischen Reizquellen; für den, welcher der träumenden Seele den größeren Teil ihrer Fähigkeiten im Wachen belassen hat, entfällt natürlich jedes Motiv, ihr nicht auch selbständige Anregungen zum Träumen zuzugestehen.
Unter den Überleistungen, welche man auch bei nüchterner Vergleichung versucht sein kann, dem Traumleben zuzuschreiben, ist die des Gedächtnisses die auffälligste; wir haben die sie beweisenden, gar nicht seltenen Erfahrungen ausführlich behandelt. Ein anderer, von alten Autoren häufig gepriesener Vorzug des Traumlebens, daß es sich souverän über Zeit– und Ortsentfernungen hinwegzusetzen vermöge, ist mit Leichtigkeit als eine Illusion zu erkennen. Dieser Vorzug ist, wie Hildebrandt bemerkt, eben ein illusorischer Vorzug; das Träumen setzt sich über Zeit und Raum nicht anders hinweg als das wache Denken, und eben weil es nur eine Form des Denkens ist. Der Traum sollte sich in Bezug auf die Zeitlichkeit noch eines anderen Vorzuges erfreuen, noch in anderem Sinne vom Ablauf der Zeit unabhängig sein. Träume wie der oben p. 20 mitgeteilte Maurys von seiner Hinrichtung durch die Guillotine scheinen zu beweisen, daß der Traum in eine sehr kurze Spanne Zeit weit mehr Wahrnehmungsinhalt zu drängen vermag, als unsere psychische Tätigkeit im Wachen Denkinhalt bewältigen kann. Diese Folgerung ist indes mit mannigfaltigen Argumenten bestritten worden; seit den Aufsätzen von Le Lorrain und Egger »über die scheinbare Dauer der Träume« hat sich hierüber eine interessante Diskussion angesponnen, welche in dieser heiklen und tiefreichenden Frage wahrscheinlich noch nicht die letzte Aufklärung erreicht hat[19 - Weitere Literatur und kritische Erörterung dieser Probleme in der Pariser Dissertation der Tobowolska (1900).].
Daß der Traum die intellektuellen Arbeiten des Tages aufzunehmen und zu einem bei Tag nicht erreichten Abschluß zu bringen vermag, daß er Zweifel und Probleme lösen, bei Dichtern und Komponisten die Quelle neuer Eingebungen werden kann, scheint nach vielfachen Berichten und nach der von Chabaneix angestellten Sammlung unbestreitbar zu sein. Aber wenn auch nicht die Tatsache, so unterliegt doch deren Auffassung vielen, ans Prinzipielle streifenden Zweifeln[20 - Vgl. die Kritik bei H. Ellis, World of Dreams, p. 268.].
Endlich bildet die behauptete divinatorische Kraft des Traumes ein Streitobjekt, an welchem schwer überwindliche Bedenken mit hartnäckig wiederholten Versicherungen zusammentreffen. Man vermeidet es – und wohl mit Recht —, alles Tatsächliche an diesem Thema abzuleugnen, weil für eine Reihe von Fällen die Möglichkeit einer natürlichen psychologischen Erklärung vielleicht nahe bevorsteht.
f) Die ethischen Gefühle im Traume
Aus Motiven, welche erst nach Kenntnisnahme meiner eigenen Untersuchungen über den Traum verständlich werden können, habe ich von dem Thema der Psychologie des Traumes das Teilproblem abgesondert, ob und inwieweit die moralischen Dispositionen und Empfindungen des Wachens sich ins Traumleben erstrecken. Der nämliche Widerspruch in der Darstellung der Autoren, den wir für alle anderen seelischen Leistungen mit Befremden bemerken mußten, macht uns auch hier betroffen. Die einen versichern mit ebensolcher Entschiedenheit, daß der Traum von den sittlichen Anforderungen nichts weiß, wie die anderen, daß die moralische Natur des Menschen auch fürs Traumleben erhalten bleibt.
Die Berufung auf die allnächtliche Traumerfahrung scheint die Richtigkeit der ersteren Behauptung über jeden Zweifel zu erheben. Jessen sagt (p. 553): »Auch besser und tugendhafter wird man nicht im Schlafe, vielmehr scheint das Gewissen in den Träumen zu schweigen, indem man kein Mitleid empfindet und die schwersten Verbrechen, Diebstahl, Mord und Totschlag mit völliger Gleichgültigkeit und ohne nachfolgende Reue verüben kann.«
Radestock (p. 146): »Es ist zu berücksichtigen, daß die Assoziationen im Traume ablaufen und die Vorstellungen sich verbinden, ohne daß Reflexion und Verstand, ästhetischer Geschmack und sittliches Urteil etwas dabei vermögen; das Urteil ist höchst schwach und es herrscht ethische Gleichgültigkeit vor.«
Volkelt (p. 23): »Besonders zügellos aber geht es, wie jeder weiß, im Traume in geschlechtlicher Beziehung zu. Wie der Träumende selbst aufs Äußerste schamlos und jedes sittlichen Gefühles und Urteiles verlustig ist, so sieht er auch alle anderen und selbst die verehrtesten Personen mitten in Handlungen, die er im Wachen auch nur in Gedanken mit ihnen zusammenzubringen sich scheuen würde.«
Den schärfsten Gegensatz hiezu bilden Äußerungen wie die von Schopenhauer, daß jeder im Traume in vollster Gemäßheit seines Charakters handle und rede. R. Ph. Fischer[21 - Grundzüge des Systems der Anthropologie. Erlangen 1850. (Nach Spitta.)] behauptet, daß die subjektiven Gefühle und Bestrebungen oder Affekte und Leidenschaften in der Willkür des Traumlebens sich offenbaren, daß die moralischen Eigentümlichkeiten der Personen in ihren Träumen sich spiegeln.
Haffner (p. 25): »Seltene Ausnahmen abgerechnet, . . . . . wird ein tugendhafter Mensch auch im Traume tugendhaft sein; er wird den Versuchungen widerstehen, dem Haß, dem Neid, dem Zorn und allen Lastern sich verschließen; der Mann der Sünde aber wird auch in seinen Träumen in der Regel die Bilder finden, die er im Wachen vor sich hatte.«
Scholz (p. 36): »Im Traume ist Wahrheit, trotz aller Maskierung in Hoheit oder Erniedrigung erkennen wir unser eigenes Selbst wieder . . . . . Der ehrliche Mann kann auch im Traume kein entehrendes Verbrechen begehen, oder wenn es doch der Fall ist, so entsetzt er sich darüber, als über etwas seiner Natur Fremdes. Der römische Kaiser, der einen seiner Untertanen hinrichten ließ, weil diesem geträumt hatte, er habe dem Kaiser den Kopf abschlagen lassen, hatte darum so unrecht nicht, wenn er dies damit rechtfertigte, daß, wer so träume, auch ähnliche Gedanken im Wachen haben müsse. Von etwas, das in unserem Innern keinen Raum haben kann, sagen wir deshalb auch bezeichnender Weise: »Es fällt mir auch im Traume nicht ein.««
Im Gegensatz hiezu meint Plato, diejenigen seien die besten, denen das, was andere wachend tun, nur im Traum einfalle.
Pfaff sagt geradezu in Abänderung eines bekannten Sprichwortes: »Erzähle mir eine Zeitlang deine Träume und ich will dir sagen, wie es um dein Inneres steht.«
Die kleine Schrift von Hildebrandt, der ich bereits so zahlreiche Zitate entnommen habe, der formvollendetste und gedankenreichste Beitrag zur Erforschung der Traumprobleme, den ich in der Literatur gefunden, rückt gerade das Problem der Sittlichkeit im Traume in den Mittelpunkt ihres Interesses. Auch für Hildebrandt steht es als Regel fest: Je reiner das Leben, desto reiner der Traum; je unreiner jenes, desto unreiner dieser.
Die sittliche Natur des Menschen bleibt auch im Traume bestehen: »Aber während kein noch so handgreiflicher Rechnungsfehler, keine noch so romantische Umkehr der Wissenschaft, kein noch so scherzhafter Anachronismus uns verletzt oder uns auch nur verdächtig wird, so geht uns doch der Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Tugend und Laster nie verloren. Wie vieles auch von dem, was am Tage mit uns geht, in den Schlummerstunden weichen mag, – Kants kategorischer Imperativ hat sich als untrennbarer Begleiter so an unsere Fersen geheftet, daß wir ihn auch schlafend nicht los werden . . . . . Erklären aber läßt sich (diese Tatsache) eben nur daraus, daß das Fundamentale der Menschennatur, das sittliche Wesen, zu fest gefügt ist, um an der Wirkung der kaleidoskopischen Durchschüttelung teilzunehmen, welcher Phantasie, Verstand, Gedächtnis und sonstige Fakultäten gleichen Ranges im Traume unterliegen« (p. 45 u. ff.).
In der weiteren Diskussion des Gegenstandes sind nun merkwürdige Verschiebungen und Inkonsequenzen bei beiden Gruppen von Autoren hervorgetreten. Streng genommen wäre für alle diejenigen, welche meinen, im Traume zerfalle die sittliche Persönlichkeit des Menschen, das Interesse an den unmoralischen Träumen mit dieser Erklärung zu Ende. Sie könnten den Versuch, den Träumer für seine Träume verantwortlich zu machen, aus der Schlechtigkeit seiner Träume auf eine böse Regung in seiner Natur zu schließen, mit derselben Ruhe ablehnen wie den anscheinend gleichwertigen Versuch, aus der Absurdität seiner Träume die Wertlosigkeit seiner intellektuellen Leistungen im Wachen zu erweisen. Die anderen, für die sich »der kategorische Imperativ« auch in den Traum erstreckt, hätten die Verantwortlichkeit für unmoralische Träume ohne Einschränkung anzunehmen; es wäre ihnen nur zu wünschen, daß eigene Träume von solch verwerflicher Art sie nicht an der sonst festgehaltenen Wertschätzung der eigenen Sittlichkeit irre machen müßten.
Nun scheint es aber, daß niemand von sich selbst so recht sicher weiß, inwieweit er gut oder böse ist und daß niemand die Erinnerung an eigene unmoralische Träume verleugnen kann. Denn über jenen Gegensatz in der Beurteilung der Traummoralität hinweg zeigen sich bei den Autoren beider Gruppen Bemühungen, die Herkunft der unsittlichen Träume aufzuklären, und es entwickelt sich ein neuer Gegensatz, je nachdem deren Ursprung in den Funktionen des psychischen Lebens oder in somatisch bedingten Beeinträchtigungen desselben gesucht wird. Die zwingende Gewalt der Tatsächlichkeit läßt dann Vertreter der Verantwortlichkeit wie der Unverantwortlichkeit des Traumlebens in der Anerkennung einer besonderen psychischen Quelle für die Unmoralität der Träume zusammentreffen.
Alle die, welche die Sittlichkeit im Traume fortbestehen lassen, hüten sich doch davor, die volle Verantwortlichkeit für ihre Träume zu übernehmen. Haffner sagt (p. 24): »Wir sind für Träume nicht verantwortlich, weil unserem Denken und Wollen die Basis entrückt ist, auf welcher unser Leben allein Wahrheit und Wirklichkeit hat . . . Es kann eben darum kein Traumwollen und Traumhandeln Tugend oder Sünde sein.« Doch ist der Mensch für den sündhaften Traum verantwortlich, sofern er ihn indirekt verursacht. Es erwächst für ihn die Pflicht, wie im Wachen, so ganz besonders vor dem Schlafengehen seine Seele sittlich zu reinigen.
Viel tiefer reicht die Analyse dieses Gemenges von Ablehnung und von Anerkennung der Verantwortlichkeit für den sittlichen Inhalt der Träume bei Hildebrandt. Nachdem er ausgeführt, daß die dramatische Darstellungsweise des Traumes, die Zusammendrängung der kompliziertesten Überlegungsvorgänge in das kleinste Zeiträumchen und die auch von ihm zugestandene Entwertung und Vermengung der Vorstellungselemente im Traume gegen den unsittlichen Anschein der Träume in Abzug gebracht werden muß, gesteht er, daß es doch den ernstesten Bedenken unterliege, alle Verantwortung für Traumsünden und –schulden schlechthin zu leugnen.
(p. 49): »Wenn wir irgend eine ungerechte Anklage, namentlich eine solche, die sich auf unsere Absichten und Gesinnungen bezieht, recht entschieden zurückweisen wollen, so gebrauchen wir wohl die Redensart: Das sei uns nicht im Traume eingefallen. Damit sprechen wir allerdings einerseits aus, daß wir das Traumgebiet für das fernste und letzte halten, auf welchem wir für unsere Gedanken einzustehen hätten, weil dort diese Gedanken mit unserem wirklichen Wesen nur so lose und locker zusammenhängen, daß sie kaum noch als die unsrigen betrachtet werden dürfen; aber indem wir eben auch auf diesem Gebiete das Vorhandensein solcher Gedanken ausdrücklich zu leugnen uns veranlaßt fühlen, so geben wir doch indirekt damit zugleich zu, daß unsere Rechtfertigung nicht vollkommen sein würde, wenn sie nicht bis dort hinüber reichte. Und ich glaube, wir reden hier, wenn auch unbewußt, die Sprache der Wahrheit.«
(p. 52): »Es läßt sich nämlich keine Traumtat denken, deren erstes Motiv nicht irgendwie als Wunsch, Gelüste, Regung vorher durch die Seele des Wachenden gezogen wäre.« Von dieser ersten Regung müsse man sagen: Der Traum erfand es nicht, – er bildete es nur nach und spann‘s nur aus, er bearbeitete nur ein Quentlein historischen Stoffes, das er bei uns vorgefunden hatte, in dramatischer Form; er setzte das Wort des Apostels in Szene: Wer seinen Bruder haßt, der ist ein Totschläger. Und während man das ganze breit ausgeführte Gebilde des lasterhaften Traumes nach dem Erwachen, seiner sittlichen Stärke bewußt, belächeln kann, so will jener ursprüngliche Bildungsstoff sich doch keine lächerliche Seite abgewinnen lassen. Man fühlt sich für die Verirrungen des Träumenden verantwortlich, nicht für die ganze Summe, aber doch für einen gewissen Prozentsatz. »Kurz verstehen wir in diesem schwer anzufechtenden Sinne das Wort Christi: Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, – dann können wir auch kaum der Überzeugung uns erwehren, daß jede im Traume begangene Sünde ein dunkles Minimum wenigstens von Schuld mit sich führe.«
In den Keimen und Andeutungen böser Regungen, die als Versuchungsgedanken tagsüber durch unsere Seelen ziehen, findet also Hildebrandt die Quelle für die Unmoralität der Träume, und er steht nicht an, diese unmoralischen Elemente bei der sittlichen Wertschätzung der Persönlichkeit einzurechnen. Es sind dieselben Gedanken und die nämliche Schätzung derselben, welche, wie wir wissen, die Frommen und Heiligen zu allen Zeiten klagen ließ, sie seien arge Sünder[22 - Es ist nicht ohne Interesse zu erfahren, wie sich die heilige Inquisition zu unserem Problem gestellt. Im Tractatus de Officio sanctissimae Inquisitionis des Thomas Careña, Lyoner Ausgabe, 1659, ist folgende Stelle: »Spricht jemand im Traum Ketzereien aus, so sollen die Inquisitoren daraus Anlaß nehmen, seine Lebensführung zu untersuchen, denn im Schlafe pflegt das wiederzukommen, was unter Tags jemand beschäftigt hat.« (Dr. Ehniger, S. Urban, Schweiz.)].
An dem allgemeinen Vorkommen dieser kontrastierenden Vorstellungen – bei den meisten Menschen und auch auf anderem als ethischem Gebiete – besteht wohl kein Zweifel. Die Beurteilung derselben ist gelegentlich eine minder ernsthafte gewesen. Bei Spitta findet sich folgende hieher gehörige Äußerung von A. Zeller (Artikel »Irre« in der allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften von Ersch und Gruber) zitiert (p. 144): »So glücklich ist selten ein Geist organisiert, daß er zu allen Zeiten volle Macht besäße und nicht immer wieder nicht allein unwesentliche, sondern auch völlig fratzenhafte und widersinnige Vorstellungen den stetigen, klaren Gang seiner Gedanken unterbrächen, ja die größten Denker haben sich über dieses traumartige, neckende und peinliche Gesindel von Vorstellungen zu beklagen gehabt, da es ihre tiefsten Betrachtungen und ihre heiligste und ernsthafteste Gedankenarbeit stört.«
Ein helleres Licht fällt auf die psychologische Stellung dieser Kontrastgedanken aus einer weiteren Bemerkung von Hildebrandt, daß der Traum uns wohl bisweilen in Tiefen und Falten unseres Wesens blicken lasse, die uns im Zustand des Wachens meist verschlossen bleiben (p. 55). Dieselbe Erkenntnis verrät Kant an einer Stelle der Anthropologie, wenn er meint, der Traum sei wohl dazu da, um uns die verborgenen Anlagen zu entdecken und uns zu offenbaren, nicht was wir sind, sondern was wir hätten werden können, wenn wir eine andere Erziehung gehabt hätten; Radestock (p. 84) mit den Worten, daß der Traum uns oft nur offenbart, was wir uns nicht gestehen wollen, und daß wir ihn darum mit Unrecht einen Lügner und Betrüger schelten. J. E. Erdmann äußert: »Mir hat nie ein Traum offenbart, was von einem Menschen zu halten sei, allein was ich von ihm halte und wie ich hinsichtlich seiner gesinnt bin, das habe ich bereits einige Male aus einem Traume gelernt zu meiner eigenen großen Überraschung.« Und ähnlich meint J. H. Fichte: »Der Charakter unserer Träume bleibt ein weit treuerer Spiegel unserer Gesamtstimmung, als was wir davon durch die Selbstbeobachtung des Wachens erfahren.« Wir werden aufmerksam gemacht, daß das Auftauchen dieser unserem sittlichen Bewußtsein fremden Antriebe nur analog ist zu der uns bereits bekannten Verfügung des Traumes über anderes Vorstellungsmaterial, welches dem Wachen fehlt oder darin eine geringfügige Rolle spielt, durch Bemerkungen wie die von Benini: »Certe nostre inclinazioni che si credevano soffocate e spente da un pezzo, si ridestano; passioni vecchie e sepolte rivivono; cose e persone a cui non pensiamo mai, ci vengono dinanzi« (p. 149) und von Volkelt: »Auch Vorstellungen, die in das wache Bewußtsein fast unbeachtet eingegangen sind und von ihm vielleicht nie wieder der Vergessenheit entzogen würden, pflegen sehr häufig dem Traum ihre Anwesenheit in der Seele kundzutun« (p. 105). Endlich ist es hier am Platze uns zu erinnern, daß nach Schleiermacher schon das Einschlafen vom Hervortreten ungewollter Vorstellungen (Bilder) begleitet war.
Als »ungewollte Vorstellungen« dürfen wir nun dies ganze Vorstellungsmaterial zusammenfassen, dessen Vorkommen in den unmoralischen wie in den absurden Träumen unser Befremden erregt. Ein wichtiger Unterschied liegt nur darin, daß die ungewollten Vorstellungen auf sittlichem Gebiete den Gegensatz zu unserem sonstigen Empfinden erkennen lassen, während die anderen uns bloß fremdartig erscheinen. Es ist bisher kein Schritt geschehen, der uns ermöglichte, diese Verschiedenheit durch tiefer gehende Erkenntnis aufzuheben.
Welche Bedeutung hat nun das Hervortreten ungewollter Vorstellungen im Traume, welche Schlüsse für die Psychologie der wachenden und der träumenden Seele lassen sich aus diesem nächtlichen Auftauchen kontrastierender ethischer Regungen ableiten? Hier ist eine neue Meinungsverschiedenheit und eine abermals verschiedene Gruppierung der Autoren zu verzeichnen. Den Gedankengang von Hildebrandt und anderen Vertretern seiner Grundansicht kann man wohl nicht anderswohin fortsetzen, als daß den unmoralischen Regungen auch im Wachen eine gewisse Macht innewohne, die zwar gehemmt ist, bis zur Tat vorzudringen, und daß im Schlafe etwas wegfalle, was, gleichfalls wie eine Hemmung wirksam, uns gehindert habe, die Existenz dieser Regung zu bemerken. Der Traum zeigte so das wirkliche, wenn auch nicht das ganze Wesen des Menschen, und gehörte zu den Mitteln, das verborgene Seeleninnere für unsere Kenntnis zugänglich zu machen. Nur von solchen Voraussetzungen her kann Hildebrandt dem Traume die Rolle eines Warners zuweisen, der uns auf verborgene sittliche Schäden unserer Seele aufmerksam macht, wie er nach dem Zugeständnis der Ärzte auch bisher unbemerkte körperliche Leiden dem Bewußtsein verkünden kann. Und auch Spitta kann von keiner anderen Auffassung geleitet sein, wenn er auf die Erregungsquellen hinweist, die zur Zeit der Pubertät z. B. der Psyche zufließen, und den Träumer tröstet, er habe alles getan, was in seinen Kräften steht, wenn er im Wachen einen streng tugendhaften Lebenswandel geführt und sich bemüht hat, die sündigen Gedanken, so oft sie kommen, zu unterdrücken, sie nicht reifen und zur Tat werden zu lassen. Nach dieser Auffassung könnten wir die »ungewollten« Vorstellungen als die während des Tages »unterdrückten« bezeichnen und müßten in ihrem Auftauchen ein echtes psychisches Phänomen erblicken.
Nach anderen Autoren hätten wir kein Recht zu letzterer Folgerung. Für Jessen stellen die ungewollten Vorstellungen im Traume wie im Wachen und in Fieber– und anderen Delirien »den Charakter einer zur Ruhe gelegten Willenstätigkeit und eines gewissermaßen mechanischen Prozesses von Bildern und Vorstellungen durch innere Bewegungen dar« (p. 360). Ein unmoralischer Traum beweise weiter nichts für das Seelenleben des Träumers, als daß dieser von dem betreffenden Vorstellungsinhalt irgendwie einmal Kenntnis gewonnen habe, gewiß nicht eine ihm eigene Seelenregung. Bei einem anderen Autor, Maury, könnte man in Zweifel geraten, ob nicht auch er dem Traumzustand die Fähigkeit zuschreibt, die seelische Tätigkeit nach ihren Komponenten zu zerlegen, anstatt sie planlos zu zerstören. Er sagt von den Träumen, in denen man sich über die Schranken der Moralität hinaussetzt: »Ce sont nos penchants qui parlent et qui nous font agir, sans que la conscience nous retienne, bien que parfois elle nous avertisse. J’ai mes défauts et mes penchants vicieux; à l’état de veille, je tâche de lutter contre eux, et il m’arrive assez souvent de n’y pas succomber. Mais dans mes songes j’y succombe toujours ou pour mieux dire j’agis par leur impulsion, sans crainte et sans remords . . . . Évidemment les visions qui se déroulent devant ma pensée et qui constituent le rêve, me sont suggérées par les incitations que je ressens et que ma volonté absente ne cherche pas à refouler« (p. 113).
Wenn man an die Fähigkeit des Traumes glaubte, eine wirklich vorhandene, aber unterdrückte oder versteckte unmoralische Disposition des Träumers zu enthüllen, so könnte man dieser Meinung schärferen Ausdruck nicht geben als mit den Worten Maurys (p. 115): »En rêve l‘homme se révèle donc tout entier à soi–même dans sa nudité et sa misère natives. Dès qu’il suspend l’exercice de sa volonté, il devient le jouet de toutes les passions contre lesquelles, à l’état de veille la conscience, le sentiment d’honneur, la crainte nous défendent.« An anderer Stelle findet er das treffende Wort (p. 462): »Dans le rêve, c‘est surtout l‘homme instinctif que se révèle . . . . L’homme revient pour ainsi dire à l’état de nature quand il rêve; mais moins les idées acquises ont pénétré dans son esprit, plus les penchants en désaccord avec elles conservent encore sur lui d’influence dans le rêve.« Er führt dann als Beispiel an, daß seine Träume ihn nicht selten als Opfer gerade jenes Aberglaubens zeigen, den er in seinen Schriften am heftigsten bekämpft hat.
Der Wert all dieser scharfsinnigen Bemerkungen für eine psychologische Erkenntnis des Traumlebens wird aber bei Maury dadurch beeinträchtigt, daß er in den von ihm so richtig beobachteten Phänomenen nichts als Beweise für den »Automatisme psychologique« sehen will, der nach ihm das Traumleben beherrscht. Diesen Automatismus faßt er als vollen Gegensatz zur psychischen Tätigkeit.
Eine Stelle in den Studien über das Bewußtsein von Stricker lautet: »Der Traum besteht nicht einzig und allein aus Täuschungen; wenn man sich im Traume z. B. vor Räubern fürchtet, so sind die Räuber zwar imaginär, die Furcht aber ist real. So wird man aufmerksam darauf gemacht, daß die Affektentwicklung im Traume die Beurteilung nicht zuläßt, welche man dem übrigen Trauminhalt schenkt und das Problem wird vor uns aufgerollt, was an den psychischen Vorgängen im Traume real sein mag, das heißt einen Anspruch auf Einreihung unter die psychischen Vorgänge des Wachens beanspruchen darf?«
g) Traumtheorien und Funktion des Traumes
Eine Aussage über den Traum, welche möglichst viele der beobachteten Charaktere desselben von einem Gesichtspunkte aus zu erklären versucht und gleichzeitig die Stellung des Traumes zu einem umfassenderen Erscheinungsgebiet bestimmt, wird man eine Traumtheorie heißen dürfen. Die einzelnen Traumtheorien werden sich darin unterscheiden, daß sie den oder jenen Charakter des Traumes zum wesentlichen erheben, Erklärungen und Beziehungen an ihn anknüpfen lassen. Eine Funktion, d. i. ein Nutzen oder eine sonstige Leistung des Traumes, wird nicht notwendig aus der Theorie ableitbar sein müssen, aber unsere auf die Teleologie gewohnheitsgemäß gerichtete Erwartung wird doch jenen Theorien entgegenkommen, die mit der Einsicht in eine Funktion des Traumes verbunden sind.
Wir haben bereits mehrere Auffassungen des Traumes kennen gelernt, die den Namen von Traumtheorien in diesem Sinne mehr oder weniger verdienten. Der Glaube der Alten, daß der Traum eine Sendung der Götter sei, um die Handlungen der Menschen zu lenken, war eine vollständige Theorie des Traumes, die über alles am Traum Wissenswerte Auskunft erteilte. Seitdem der Traum ein Gegenstand der biologischen Forschung geworden ist, kennen wir eine größere Anzahl von Traumtheorien, aber darunter auch manche recht unvollständige.
Wenn man auf Vollzähligkeit verzichtet, kann man etwa folgende lockere Gruppierung der Traumtheorien versuchen, je nach der zu grunde gelegten Annahme über Maß und Art der psychischen Tätigkeit im Traume:
1. Solche Theorien, welche die volle psychische Tätigkeit des Wachens sich in dem Traume fortsetzen lassen, wie die von Delboeuf. Hier schläft die Seele nicht, ihr Apparat bleibt intakt, aber unter die vom Wachen abweichenden Bedingungen des Schlafzustandes gebracht, muß sie bei normalem Funktionieren andere Ergebnisse liefern als im Wachen. Bei diesen Theorien fragt es sich, ob sie im stande sind, die Unterschiede des Traumes von dem Nachdenken sämtlich aus den Bedingungen des Schlafzustandes abzuleiten. Überdies fehlt ihnen ein möglicher Zugang zu einer Funktion des Traumes; man sieht nicht ein, wozu man träumt, warum der komplizierte Mechanismus des seelischen Apparates weiter spielt, auch wenn er in Verhältnisse versetzt wird, für die er nicht berechnet scheint. Traumlos schlafen, oder wenn störende Reize kommen, aufwachen, bleiben die einzig zweckmäßigen Reaktionen anstatt der dritten, der des Träumens.
2. Solche Theorien, welche im Gegenteil für den Traum eine Herabsetzung der psychischen Tätigkeit, eine Auflockerung der Zusammenhänge, eine Verarmung an anspruchsfähigem Material annehmen. Diesen Theorien zufolge müßte eine ganz andere psychologische Charakteristik des Schlafes gegeben werden als etwa nach Delboeuf. Der Schlaf erstreckt sich weit über die Seele, er besteht nicht bloß in einer Absperrung der Seele von der Außenwelt, er dringt vielmehr in ihren Mechanismus ein und macht ihn zeitweilig unbrauchbar. Wenn ich einen Vergleich mit psychiatrischem Material heranziehen darf, so möchte ich sagen, die ersteren Theorien konstruieren den Traum wie eine Paranoia, die zweiterwähnten machen ihn zum Vorbilde des Schwachsinnes oder einer Amentia.
Die Theorie, daß im Traumleben nur ein Bruchteil der durch den Schlaf lahmgelegten Seelentätigkeit zum Ausdruck komme, ist die bei ärztlichen Schriftstellern und in der wissenschaftlichen Welt überhaupt weit bevorzugte. Soweit ein allgemeineres Interesse für Traumerklärung vorauszusetzen ist, darf man sie wohl als die herrschende Theorie des Traumes bezeichnen. Es ist hervorzuheben, mit welcher Leichtigkeit gerade diese Theorie die ärgste Klippe jeder Traumerklärung, nämlich das Scheitern an einem der durch den Traum verkörperten Gegensätze, vermeidet. Da ihr der Traum das Ergebnis eines partiellen Wachens ist (»ein allmähliches, partielles und zugleich sehr anomalisches Wachen« sagt Herbarts Psychologie über den Traum), so kann sie durch eine Reihe von Zuständen von immer weitergehender Erweckung bis zur vollen Wachheit die ganze Reihe von der Minderleistung des Traumes, die sich durch Absurdität verrät, bis zur voll konzentrierten Denkleistung decken.
Wem die physiologische Darstellungsweise unentbehrlich geworden ist oder wissenschaftlicher dünkt, der wird diese Theorie des Traumes in der Schilderung von Binz ausgedrückt finden (p. 43):
»Dieser Zustand (von Erstarrung) aber geht in den frühen Morgenstunden nur allmählich seinem Ende entgegen. Immer geringer werden die in dem Gehirneiweiß aufgehäuften Ermüdungsstoffe und immer mehr von ihnen wird zerlegt oder von dem rastlos treibenden Blutstrom fortgespült. Da und dort leuchten schon einzelne Zellenhaufen wach geworden hervor, während ringsumher noch alles in Erstarrung ruht. Es tritt nun die isolierte Arbeit der Einzelgruppen vor unser umnebeltes Bewußtsein und zu ihr fehlt die Kontrolle anderer, der Assoziation vorstehender Gehirnteile. Darum fügen die geschaffenen Bilder, welche meist den materiellen Eindrücken naheliegender Vergangenheit entsprechen, sich wild und regellos aneinander. Immer größer wird die Zahl der freiwerdenden Gehirnzellen, immer geringer die Unvernunft des Traumes.«
Man wird die Auffassung des Träumens als eines unvollständigen, partiellen Wachens oder Spuren von ihrem Einflusse sicherlich bei allen modernen Physiologen und Philosophen finden. Am ausführlichsten ist sie bei Maury dargestellt. Dort hat es oft den Anschein, als stellte sich der Autor das Wachsein oder Eingeschlafensein nach anatomischen Regionen verschiebbar vor, wobei ihm allerdings eine anatomische Provinz und eine bestimmte psychische Funktion aneinander gebunden erscheinen. Ich möchte hier aber nur andeuten, daß, wenn die Theorie des partiellen Wachens sich bestätigte, über den feineren Ausbau derselben sehr viel zu verhandeln wäre.
Eine Funktion des Traumes kann sich bei dieser Auffassung des Traumlebens natürlich nicht herausstellen. Vielmehr wird das Urteil über die Stellung und Bedeutung des Traumes konsequenterweise durch die Äußerung von Binz gegeben (p. 357): »Alle Tatsachen, wie wir sehen, drängen dahin, den Traum als einen körperlichen, in allen Fällen unnützen, in vielen Fällen geradezu krankhaften Vorgang zu kennzeichnen . . .«
Der Ausdruck »körperlich« mit Beziehung auf den Traum, der seine Hervorhebung dem Autor selbst verdankt, weist wohl nach mehr als einer Richtung. Er bezieht sich zunächst auf die Traumätiologie, die ja Binz besonders nahe lag, wenn er die experimentelle Erzeugung von Träumen durch Darreichung von Giften studierte. Es liegt nämlich im Zusammenhange dieser Art von Traumtheorien, die Anregung zum Träumen womöglich ausschließlich von somatischer Seite ausgehen zu lassen. In extremster Form dargestellt, lautete es so: Nachdem wir durch Entfernung der Reize uns in Schlaf versetzt haben, wäre zum Träumen kein Bedürfnis und kein Anlaß bis zum Morgen, wo das allmähliche Erwachen durch die neu anlangenden Reize sich in dem Phänomen des Träumens spiegeln könnte. Nun gelingt es aber nicht, den Schlaf reizlos zu halten; es kommen, ähnlich wie Mephisto von den Lebenskeimen klagt, von überall her Reize an den Schlafenden heran, von außen, von innen, von all den Körpergebieten sogar, um die man sich als Wachender nie gekümmert hat. So wird der Schlaf gestört, die Seele bald an dem, bald an jenem Zipfelchen wachgerüttelt und funktioniert dann ein Weilchen mit dem geweckten Teil, froh wieder einzuschlafen. Der Traum ist die Reaktion auf die durch den Reiz verursachte Schlafstörung, übrigens eine rein überflüssige Reaktion.
Den Traum, der doch immerhin eine Leistung des Seelenorgans bleibt, als einen körperlichen Vorgang zu bezeichnen, hat aber auch noch einen anderen Sinn. Es ist die Würde eines psychischen Vorganges, die damit dem Traume abgesprochen werden soll. Das in seiner Anwendung auf den Traum bereits sehr alte Gleichnis von den »zehn Fingern eines der Musik ganz unkundigen Menschen, die über die Tasten des Instrumentes hinlaufen«, veranschaulicht vielleicht am besten, welche Würdigung die Traumleistung bei den Vertretern der exakten Wissenschaft zumeist gefunden hat. Der Traum wird in dieser Auffassung etwas ganz und gar Undeutbares; denn wie sollten die zehn Finger des unmusikalischen Spielers ein Stück Musik produzieren können?
Es hat der Theorie des partiellen Wachens schon frühzeitig nicht an Einwänden gefehlt. Burdach meint 1830: »Wenn man sagt, der Traum sei ein partielles Wachen, so wird damit erstlich weder das Wachen, noch das Schlafen erklärt, zweitens nichts anderes gesagt, als daß einige Kräfte der Seele im Traume tätig sind, während andere ruhen. Aber solche Ungleichheit findet während des ganzen Lebens statt . . .« (p. 483).
An die herrschende Traumtheorie, welche im Traume einen »körperlichen« Vorgang sieht, lehnt sich eine sehr interessante Auffassung des Traumes an, die erst 1866 von Robert ausgesprochen wurde und die bestechend wirkt, weil sie für das Träumen eine Funktion, einen nützlichen Erfolg anzugeben weiß. Robert nimmt zur Grundlage seiner Theorie zwei Tatsachen der Beobachtung, bei denen wir bereits in der Würdigung des Traummaterials verweilt haben (vgl. p. 14), nämlich daß man so häufig von den nebensächlichsten Eindrücken des Tages träumt und daß man so selten die großen Interessen des Tages mit hinübernimmt. Robert behauptet als ausschließlich richtig: »Es werden nie Dinge, die man voll ausgedacht hat, zu Traumerregern, immer nur solche, die einem unfertig im Sinne liegen oder den Geist flüchtig streifen« (p. 10). – »Darum kann man meistens den Traum sich nicht erklären, weil die Ursachen desselben eben die nicht zum genügenden Erkennen des Träumenden gekommenen Sinneseindrücke des verflossenen Tages sind.« Die Bedingung, daß ein Eindruck in den Traum gelange, ist also, entweder daß dieser Eindruck in seiner Verarbeitung gestört wurde oder daß er als allzu unbedeutend auf solche Verarbeitung keinen Anspruch hatte.
Der Traum stellt sich Robert nun dar »als ein körperlicher Ausscheidungsprozeß, der in seiner geistigen Reaktionserscheinung zum Erkennen gelangt«. Träume sind Ausscheidungen von im Keime erstickten Gedanken. »Ein Mensch, dem man die Fähigkeit nehmen würde, zu träumen, müßte in gegebener Zeit geistesgestört werden, weil sich in seinem Hirn eine Unmasse unfertiger, unausgedachter Gedanken und seichter Eindrücke ansammeln würde, unter deren Wucht dasjenige ersticken müßte, was dem Gedächtnisse als fertiges Ganzes einzuverleiben wäre.« Der Traum leistet dem überbürdeten Gehirn die Dienste eines Sicherheitsventils. Die Träume haben heilende, entlastende Kraft (p. 32).
Es wäre mißverständlich, an Robert die Frage zu richten, wie denn durch das Vorstellen im Traume eine Entlastung der Seele herbeigeführt werden kann. Der Autor schließt offenbar aus jenen beiden Eigentümlichkeiten des Traummaterials, daß während des Schlafes eine solche Ausstoßung von wertlosen Eindrücken irgendwie als somatischer Vorgang vollzogen werde, und das Träumen ist kein besonderer psychischer Prozeß, sondern nur die Kunde, die wir von jener Aussonderung erhalten. Übrigens ist eine Ausscheidung nicht das einzige, was nachts in der Seele vorgeht. Robert fügt selbst hinzu, daß überdies die Anregungen des Tages ausgearbeitet werden, und »was sich von dem unverdaut im Geiste liegenden Gedankenstoff nicht ausscheiden läßt, wird durch der Phantasie entlehnte Gedankenfäden zu einem abgerundeten Ganzen verbunden und so dem Gedächtnisse als unschädliches Phantasiegemälde eingereiht« (p. 23).
In den schroffsten Gegensatz zur herrschenden Theorie tritt die Roberts aber in der Beurteilung der Traumquellen. Während dort überhaupt nicht geträumt würde, wenn nicht die äußeren und inneren Sensationsreize die Seele immer wieder weckten, liegt der Antrieb zum Träumen nach der Theorie Roberts in der Seele selbst, in ihrer Überladung, die nach Entlastung verlangt, und Robert urteilt vollkommen konsequent, daß die im körperlichen Befinden liegenden traumbedingenden Ursachen einen untergeordneten Rang einnehmen und einen Geist, in dem kein dem wachen Bewußtsein entnommener Stoff zur Traumbildung wäre, keinesfalls zum Träumen veranlassen könnten. Zuzugeben sei bloß, daß die im Traume aus den Tiefen der Seele heraus sich entwickelnden Phantasiebilder durch die Nervenreize beeinflußt werden können (p. 48). So ist der Traum nach Robert doch nicht so ganz abhängig vom Somatischen, er ist zwar kein psychischer Vorgang, hat keine Stelle unter den psychischen Vorgängen des Wachens, er ist ein allnächtlicher somatischer Vorgang am Apparat der Seelentätigkeit und hat eine Funktion zu erfüllen, diesen Apparat vor Überspannung zu behüten oder wenn man das Gleichnis wechseln darf: die Seele auszumisten.
Auf die nämlichen Charaktere des Traumes, die in der Auswahl des Traummaterials deutlich werden, stützt ein anderer Autor, Yves Delage, seine eigene Theorie, und es ist lehrreich zu beobachten, wie durch eine leise Wendung in der Auffassung derselben Dinge ein Endergebnis von ganz anderer Tragweite gewonnen wird.
Delage hatte an sich selbst, nachdem er eine ihm teure Person durch den Tod verloren, die Erfahrung gemacht, daß man von dem nicht träumt, was einen tagsüber ausgiebig beschäftigt hat, oder erst dann, wenn es anderen Interessen tagsüber zu weichen beginnt. Seine Nachforschungen bei anderen Personen bestätigten ihm die Allgemeinheit dieses Sachverhaltes. Eine schöne Bemerkung dieser Art, wenn sie sich als allgemein richtig herausstellte, macht Delage über das Träumen junger Eheleute: »S‘ils ont été fortement épris, presque jamais ils n‘ont rêvé l‘un de l‘autre avant le mariage ou pendant la lune de miel; et s‘ils ont rêvé d‘amour c‘est pour être infidèles avec quelque personne indifférente ou odieuse.« Wovon träumt man nun aber? Delage erkennt das in unseren Träumen vorkommende Material als bestehend aus Bruchstücken und Resten von Eindrücken der letzten Tage und früherer Zeiten. Alles was in unseren Träumen auftritt, was wir zuerst geneigt sein mögen, als Schöpfung des Traumlebens anzusehen, erweist sich bei genauerer Prüfung als unerkannte Reproduktion, als »souvenir inconscient«. Aber dieses Vorstellungsmaterial zeigt einen gemeinsamen Charakter, es rührt von Eindrücken her, die unsere Sinne wahrscheinlich stärker betroffen haben als unseren Geist oder von denen die Aufmerksamkeit sehr bald nach ihrem Auftauchen wieder abgelenkt wurde. Je weniger bewußt und dabei je stärker ein Eindruck gewesen ist, desto mehr Aussicht hat er, im nächsten Traume eine Rolle zu spielen.
Es sind im wesentlichen dieselben zwei Kategorien von Eindrücken, die nebensächlichen und die unerledigten, wie sie Robert hervorhebt, aber Delage wendet den Zusammenhang anders, indem er meint, diese Eindrücke werden nicht, weil sie gleichgültig sind, traumfähig, sondern weil sie unerledigt sind. Auch die nebensächlichen Eindrücke sind gewissermaßen nicht voll erledigt worden, auch sie sind ihrer Natur nach als neue Eindrücke »autant de ressorts tendus«, die sich während des Schlafes entspannen werden. Noch mehr Anrecht auf eine Rolle im Traume als der schwache und fast unbeachtete Eindruck wird ein starker Eindruck haben, der zufällig in seiner Verarbeitung aufgehalten wurde oder mit Absicht zurückgedrängt worden ist. Die tagsüber durch Hemmung und Unterdrückung aufgespeicherte psychische Energie wird nachts die Triebfeder des Traumes. Im Traume kommt das psychisch Unterdrückte zum Vorschein[23 - Ganz ähnlich äußert sich der Dichter Anatole France (Lys rouge): Ce que nous voyons la nuit, ce sont les restes malheureux de ce que nous avons négligé dans la veille. Le rêve est souvent la revanche des choses qu'on méprise ou le reproche des êtres abandonnés.].
Leider bricht der Gedankengang von Delage an dieser Stelle ab; er kann einer selbständigen psychischen Tätigkeit im Traume nur die geringste Rolle einräumen und so schließt er sich mit seiner Traumtheorie unvermittelt wieder an die herrschende Lehre vom partiellen Schlafen des Gehirns an: »En somme le rêve est le produit de la pensée errante, sans but et sans direction, se fixant successivement sur les souvenirs, qui ont gardé assez d‘intensité pour se placer sur sa route et l‘arrêter au passage, établissant entre eux un lien tantôt faible et indécis, tantôt plus fort et plus serré selon que l‘activité actuelle du cerveau est plus ou moins abolie par le sommeil.«
3. Zu einer dritten Gruppe kann man jene Theorien des Traumes vereinigen, welche der träumenden Seele die Fähigkeit und Neigung zu besonderen psychischen Leistungen zuschreiben, die sie im Wachen entweder gar nicht oder nur in unvollkommener Weise ausführen kann. Aus der Betätigung dieser Fähigkeiten ergibt sich zumeist eine nützliche Funktion des Traumes. Die Wertschätzungen, welche der Traum bei älteren psychologischen Autoren gefunden hat, gehören meist in diese Reihe. Ich will mich aber damit begnügen, an deren Statt die Äußerung von Burdach anzuführen, derzufolge der Traum »die Naturtätigkeit der Seele ist, welche nicht durch die Macht der Individualität beschränkt, nicht durch Selbstbewußtsein gestört, nicht durch Selbstbestimmung gerichtet wird, sondern die in freiem Spiele sich ergehende Lebendigkeit der sensiblen Zentralpunkte ist« (p. 486).
Dieses Schwelgen im freien Gebrauche der eigenen Kräfte stellen sich Burdach u. a. offenbar als einen Zustand vor, in welchem die Seele sich erfrischt und neue Kräfte für die Tagesarbeit sammelt, also etwa nach Art eines Ferienurlaubes. Burdach zitiert und akzeptiert darum auch die liebenswürdigen Worte, in denen der Dichter Novalis das Walten des Traumes preist: »Der Traum ist eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens, eine freie Erholung der gebundenen Phantasie, wo sie alle Bilder des Lebens durcheinander wirft und die beständige Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel unterbricht; ohne die Träume würden wir gewiß früher alt, und so kann man den Traum, wenn auch nicht als unmittelbar von oben gegeben, doch als eine köstliche Aufgabe, als einen freundlichen Begleiter auf der Wallfahrt zum Grabe betrachten.«
Die erfrischende und heilende Tätigkeit des Traumes schildert noch eindringlicher Purkinje (p. 456): »Besonders würden die produktiven Träume diese Funktionen vermitteln. Es sind leichte Spiele der Imagination, die mit den Tagesbegebenheiten keinen Zusammenhang haben. Die Seele will die Spannungen des wachen Lebens nicht fortsetzen, sondern sie auflösen, sich von ihnen erholen. Sie erzeugt zuvörderst denen des Wachens entgegengesetzte Zustände. Sie heilt Traurigkeit durch Freude, Sorgen durch Hoffnungen und heitere zerstreuende Bilder, Haß durch Liebe und Freundlichkeit, Furcht durch Mut und Zuversicht; den Zweifel beschwichtigt sie durch Überzeugung und festen Glauben, vergebliche Erwartung durch Erfüllung. Viele wunde Stellen des Gemütes, die der Tag immerwährend offen erhalten würde, heilt der Schlaf, indem er sie zudeckt und vor neuer Aufregung bewahrt. Darauf beruht zum Teil die schmerzenheilende Wirkung der Zeit.« Wir empfinden es alle, daß der Schlaf eine Wohltat für das Seelenleben ist, und die dunkle Ahnung des Volksbewußtseins läßt sich offenbar das Vorurteil nicht rauben, daß der Traum einer der Wege ist, auf denen der Schlaf seine Wohltaten spendet.
Der originellste und weitgehendste Versuch, den Traum aus einer besonderen Tätigkeit der Seele, die sich erst im Schlafzustand frei entfalten kann, zu erklären, ist der von Scherner 1861 unternommene. Das Buch Scherners, in einem schwülen und schwülstigen Stil geschrieben, von einer nahezu trunkenen Begeisterung für den Gegenstand getragen, die abstoßend wirken muß, wenn sie nicht mit sich fortzureißen vermag, setzt einer Analyse solche Schwierigkeiten entgegen, daß wir bereitwillig nach der klareren und kürzeren Darstellung greifen, in welcher der Philosoph Volkelt die Lehren Scherners uns vorführt. »Es blitzt und leuchtet wohl aus den mystischen Zusammenballungen, aus all dem Pracht– und Glanzgewoge ein ahnungsvoller Schein von Sinn heraus, allein hell werden hiedurch des Philosophen Pfade nicht.« Solche Beurteilung findet die Darstellung Scherners selbst bei seinem Anhänger.
Scherner gehört nicht zu den Autoren, welche der Seele gestatten, ihre Fähigkeiten unverringert ins Traumleben mitzunehmen. Er führt selbst aus, wie im Traume die Zentralität, die Spontanenergie des Ich entnervt wird, wie infolge dieser Dezentralisation Erkennen, Fühlen, Wollen und Vorstellen verändert werden und wie den Überbleibseln dieser Seelenkräfte kein wahrer Geistcharakter, sondern nur noch die Natur eines Mechanismus zukommt. Aber dafür schwingt sich im Traume die als Phantasie zu benennende Tätigkeit der Seele, frei von aller Verstandesherrschaft und damit der strengen Maße ledig, zur unbeschränkten Herrschaft auf. Sie nimmt zwar die letzten Bausteine aus dem Gedächtnis des Wachens, aber führt aus ihnen Gebäude auf, die von den Gebilden des Wachens himmelweit verschieden sind, sie zeigt sich im Traume nicht nur reproduktiv, sondern auch produktiv. Ihre Eigentümlichkeiten verleihen dem Traumleben seine besonderen Charaktere. Sie zeigt eine Vorliebe für das Ungemessene, Übertriebene, Ungeheuerliche. Zugleich aber gewinnt sie durch die Befreiung von den hinderlichen Denkkategorien eine größere Schmiegsamkeit, Behendigkeit, Wendungslust; sie ist aufs feinste empfindsam für die zarten Stimmungsreize des Gemütes, für die wühlerischen Affekte, sie bildet sofort das innere Leben in die äußere plastische Anschaulichkeit hinein. Der Traumphantasie fehlt die Begriffssprache; was sie sagen will, muß sie anschaulich hinmalen, und da der Begriff hier nicht schwächend einwirkt, malt sie es in Fülle, Kraft und Größe der Anschauungsform hin. Ihre Sprache wird hiedurch, so deutlich sie ist, weitläufig, schwerfällig, unbeholfen. Besonders erschwert wird die Deutlichkeit ihrer Sprache dadurch, daß sie die Abneigung hat, ein Objekt durch sein eigentliches Bild auszudrücken und lieber ein fremdes Bild wählt, insofern dieses nur dasjenige Moment des Objektes, an dessen Darstellung ihr liegt, durch sich auszudrücken im stande ist. Das ist die symbolisierende Tätigkeit der Phantasie . . . Sehr wichtig ist ferner, daß die Traumphantasie die Gegenstände nicht erschöpfend, sondern nur in ihrem Umriß und diesen in freiester Weise nachbildet. Ihre Malereien erscheinen daher wie genial hingehaucht. Die Traumphantasie bleibt aber nicht bei der bloßen Hinstellung des Gegenstandes stehen, sondern sie ist innerlich genötigt, das Traum–Ich mehr oder weniger mit ihm zu verwickeln und so eine Handlung zu erzeugen. Der Gesichtsreiztraum z. B. malt Goldstücke auf die Straße; der Träumer sammelt sie, freut sich, trägt sie davon.
Das Material, an welchem die Traumphantasie ihre künstlerische Tätigkeit vollzieht, ist nach Scherner vorwiegend das der bei Tag so dunklen organischen Leibreize (vgl. p. 25), so daß in der Annahme der Traumquellen und Traumerreger die allzu phantastische Theorie Scherners und die vielleicht übernüchterne Lehre Wundts und anderer Physiologen, die sich sonst wie Antipoden zueinander verhalten, sich hier völlig decken. Aber während nach der physiologischen Theorie die seelische Reaktion auf die inneren Leibreize mit der Erweckung von irgend zu ihnen passenden Vorstellungen erschöpft ist, die dann einige andere Vorstellungen auf dem Wege der Assoziation sich zur Hilfe rufen, und mit diesem Stadium die Verfolgung der psychischen Vorgänge des Traumes beendigt scheint, geben die Leibreize nach Scherner der Seele nur ein Material, das sie ihren phantastischen Absichten dienstbar machen kann. Die Traumbildung fängt für Scherner dort erst an, wo sie für den Blick der anderen versiegt.
Zweckmäßig wird man freilich nicht finden können, was die Traumphantasie mit den Leibreizen vornimmt. Sie treibt ein neckendes Spiel mit ihnen, stellt sich die Organquelle, aus der die Reize im betreffenden Traume stammen, in irgend einer plastischen Symbolik vor. Ja Scherner meint, worin Volkelt und andere ihm nicht folgen, daß die Traumphantasie eine bestimmte Lieblingsdarstellung für den ganzen Organismus habe; diese wäre das Haus. Sie scheint sich aber zum Glück für ihre Darstellungen nicht an diesen Stoff zu binden; sie kann auch umgekehrt ganze Reihen von Häusern benutzen, um ein einzelnes Organ zu bezeichnen, z. B. sehr lange Häuserstraßen für den Eingeweidereiz. Andere Male stellen einzelne Teile des Hauses wirklich einzelne Körperteile dar, so z. B. im Kopfschmerztraum die Decke eines Zimmers (welche der Träumer mit ekelhaften krötenartigen Spinnen bedeckt sieht) den Kopf.
Von der Haussymbolik ganz abgesehen, werden beliebige andere Gegenstände zur Darstellung der den Traumreiz ausschickenden Körperteile verwendet. »So findet die atmende Lunge in dem flammenerfüllten Ofen mit seinem luftartigen Brausen ihr Symbol, das Herz in hohlen Kisten und Körben, die Harnblase in runden beutelförmigen oder überhaupt nur ausgehöhlten Gegenständen. Der männliche Geschlechtsreiztraum läßt den Träumer den oberen Teil einer Klarinette, daneben den gleichen Teil einer Tabakspfeife, daneben wieder einen Pelz auf der Straße finden. Klarinette und Tabakspfeife stellen die annähernde Form des männlichen Gliedes, der Pelz das Schamhaar dar. Im weiblichen Geschlechtstraume kann sich die Schrittenge der zusammenschließenden Schenkel durch einen schmalen, von Häusern umschlossenen Hof, die weibliche Scheide durch einen mitten durch den Hofraum führenden, schlüpfrig weichen, sehr schmalen Fußpfad symbolisieren, den die Träumerin wandeln muß, um etwa einen Brief zu einem Herrn zu tragen« (Volkelt p. 39). Besonders wichtig ist es, daß am Schlusse eines solchen Leibreiztraumes die Traumphantasie sich sozusagen demaskiert, indem sie das erregende Organ oder dessen Funktion unverhüllt hinstellt. So schließt der »Zahnreiztraum« gewöhnlich damit, daß der Träumer sich einen Zahn aus dem Munde nimmt.
Die Traumphantasie kann ihre Aufmerksamkeit aber nicht bloß der Form des erregenden Organs zuwenden, sie kann ebensowohl die in ihm enthaltene Substanz zum Objekt der Symbolisierung nehmen. So führt z. B. der Eingeweidereiztraum durch kotige Straßen, der Harnreiztraum an schäumendes Wasser. Oder der Reiz als solcher, die Art seiner Erregtheit, das Objekt, das er begehrt, werden symbolisch dargestellt oder das Traum–Ich tritt in konkrete Verbindung mit den Symbolisierungen des eigenen Zustandes, z. B. wenn wir bei Schmerzreizen uns mit beißenden Hunden oder tobenden Stieren verzweifelt balgen oder die Träumerin sich im Geschlechtstraume von einem nackten Manne verfolgt sieht. Von all dem möglichen Reichtum in der Ausführung abgesehen, bleibt eine symbolisierende Phantasietätigkeit als die Zentralkraft eines jeden Traumes bestehen. In den Charakter dieser Phantasie näher einzudringen, der so erkannten psychischen Tätigkeit ihre Stellung in einem System philosophischer Gedanken anzuweisen, versuchte dann Volkelt in seinem schön und warm geschriebenen Buche, das aber allzu schwer verständlich für jeden bleibt, der nicht durch frühe Schulung für das ahnungsvolle Erfassen philosophischer Begriffsschemen vorbereitet ist.
Eine nützliche Funktion ist mit der Betätigung der symbolisierenden Phantasie Scherners in den Träumen nicht verbunden. Die Seele spielt träumend mit den ihr dargebotenen Reizen. Man könnte auf die Vermutung kommen, daß sie unartig spielt. Man könnte aber auch an uns die Frage richten, ob unsere eingehende Beschäftigung mit Scherners Theorie des Traumes zu irgend etwas Nützlichem führen kann, deren Willkürlichkeit und Losgebundenheit von den Regeln aller Forschung doch allzu augenfällig scheint. Da wäre es denn am Platze, gegen eine Verwerfung der Lehre Scherners vor aller Prüfung als allzu hochmütig ein Veto einzulegen. Diese Lehre baut sich auf dem Eindruck auf, den jemand von seinen Träumen empfing, der ihnen große Aufmerksamkeit schenkte, und der persönlich sehr wohl veranlagt scheint, dunklen seelischen Dingen nachzuspüren. Sie handelt ferner von einem Gegenstand, der den Menschen durch Jahrtausende rätselhaft, wohl aber zugleich inhalts– und beziehungsreich erschienen ist, und zu dessen Erhellung die gestrenge Wissenschaft, wie sie selbst bekennt, nicht viel anderes beigetragen hat, als daß sie im vollen Gegensatz zur populären Empfindung dem Objekt Inhalt und Bedeutsamkeit abzusprechen versuchte. Endlich wollen wir uns ehrlich sagen, daß es den Anschein hat, wir könnten bei den Versuchen, den Traum aufzuklären, der Phantastik nicht leicht entgehen. Es gibt auch Ganglienzellen–Phantastik; die p. 58 zitierte Stelle eines nüchternen und exakten Forschers wie Binz, welche schildert, wie die Aurora des Erwachens über die eingeschlafenen Zellhaufen der Hirnrinde hinzieht, steht an Phantastik und an – Unwahrscheinlichkeit hinter den Schernerschen Deutungsversuchen nicht zurück. Ich hoffe, zeigen zu können, daß hinter den letzteren etwas Reelles steckt, das allerdings nur verschwommen erkannt worden ist und nicht den Charakter der Allgemeinheit besitzt, auf den eine Theorie des Traumes Anspruch erheben kann. Vorläufig kann uns die Schernersche Theorie des Traumes in ihrem Gegensatz zur medizinischen etwa vor Augen führen, zwischen welchen Extremen die Erklärung des Traumlebens heute noch unsicher schwankt.
h) Beziehungen zwischen Traum und Geisteskrankheiten
Wer von den Beziehungen des Traumes zu den Geistesstörungen spricht, kann dreierlei meinen: 1. ätiologische und klinische Beziehungen, etwa wenn ein Traum einen psychotischen Zustand vertritt, einleitet oder nach ihm erübrigt. 2. Veränderungen, die das Traumleben im Falle der Geisteskrankheiten erleidet. 3. Innere Beziehungen zwischen Traum und Psychosen, Analogien, die auf Wesensverwandtschaft hindeuten. Diese mannigfachen Beziehungen zwischen den beiden Reihen von Phänomenen sind in früheren Zeiten der Medizin – und in der Gegenwart von neuem wieder – ein Lieblingsthema ärztlicher Autoren gewesen, wie die bei Spitta, Radestock, Maury und Tissié gesammelte Literatur des Gegenstandes lehrt. Jüngst hat Sante de Sanctis diesem Zusammenhange seine Aufmerksamkeit zugewendet[24 - Spätere Autoren, die solche Beziehungen behandeln, sind: Féré, Ideler, Lasègne, Pichon, Régis, Vespa, Giessler, Kazodowsky, Pachantoni u. a.]. Dem Interesse unserer Darstellung wird es genügen, den bedeutsamen Gegenstand bloß zu streifen.
Zu den klinischen und ätiologischen Beziehungen zwischen Traum und Psychosen will ich folgende Beobachtungen als Paradigmata mitteilen. Hohnbaum berichtet (bei Krauss), daß der erste Ausbruch des Wahnsinns sich öfters von einem ängstlichen schreckhaften Traume herschrieb und daß die vorherrschende Idee mit diesem Traume in Verbindung stand. Sante de Sanctis bringt ähnliche Beobachtungen von Paranoischen und erklärt den Traum in einzelnen derselben für die »vraie cause déterminante de la folie«. Die Psychose kann mit dem wirksamen, die wahnhafte Erklärung enthaltenden Traum mit einem Schlage ins Leben treten oder sich durch weitere Träume, die noch gegen Zweifel anzukämpfen haben, langsam entwickeln. In einem Falle von de Sanctis schlossen sich an den ergreifenden Traum leichte hysterische Anfälle, dann in weiterer Folge ein ängstlich–melancholischer Zustand. Féré (bei Tissié) berichtet von einem Traume, der eine hysterische Lähmung zur Folge hatte. Hier wird uns der Traum als Ätiologie der Geistesstörung vorgeführt, obwohl wir dem Tatbestand ebenso Rechnung tragen, wenn wir aussagen, die geistige Störung habe ihre erste Äußerung am Traumleben gezeigt, sei im Traume zuerst durchgebrochen. In anderen Beispielen enthält das Traumleben die krankhaften Symptome oder die Psychose bleibt aufs Traumleben eingeschränkt. So macht Thomayer auf Angstträume aufmerksam, die als Äquivalente von epileptischen Anfällen aufgefaßt werden müssen. Allison hat nächtliche Geisteskrankheit (nocturnal insanity) beschrieben (nach Radestock), bei der die Individuen tagsüber anscheinend vollkommen gesund sind, während bei Nacht regelmäßig Halluzinationen, Tobsuchtsanfälle u. dgl. auftreten. Ähnliche Beobachtungen bei de Sanctis (paranoisches Traumäquivalent bei einem Alkoholiker, Stimmen, die die Ehefrau der Untreue beschuldigen); bei Tissié. Tissié bringt aus neuerer Zeit eine reiche Anzahl von Beobachtungen, in denen Handlungen pathologischen Charakters (aus Wahnvoraussetzungen, Zwangimpulse) sich aus Träumen ableiten. Guislain beschreibt einen Fall, in dem der Schlaf durch ein intermittierendes Irresein ersetzt war.
Es ist wohl kein Zweifel, daß eines Tages neben der Psychologie des Traumes eine Psychopathologie des Traumes die Ärzte beschäftigen wird.
Besonders deutlich wird es häufig in Fällen von Genesung nach Geisteskrankheit, daß bei gesunder Funktion am Tage das Traumleben noch der Psychose angehören kann. Gregory soll auf dieses Vorkommen zuerst aufmerksam gemacht haben (nach Krauss). Macario (bei Tissié) erzählt von einem Maniacus, der eine Woche nach seiner völligen Herstellung in Träumen die Ideenflucht und die leidenschaftlichen Antriebe seiner Krankheit wieder erlebte.
Über die Veränderungen, welche das Traumleben bei dauernd Psychotischen erfährt, sind bis jetzt nur sehr wenige Untersuchungen angestellt worden. Dagegen hat die innere Verwandtschaft zwischen Traum und Geistesstörung, die sich in so weitgehender Übereinstimmung der Erscheinungen beider äußert, frühzeitig Beachtung gefunden. Nach Maury hat zuerst Cabanis in seinen »Rapports du physique et du moral« auf sie hingewiesen, nach ihm Lélut, J. Moreau und ganz besonders der Philosoph Maine de Biran. Sicherlich ist die Vergleichung noch älter. Radestock leitet das Kapitel, in dem er sie behandelt, mit einer Sammlung von Aussprüchen ein, welche Traum und Wahnsinn in Analogie bringen. Kant sagt an einer Stelle: »Der Verrückte ist ein Träumer im Wachen.« Krauss: »Der Wahnsinn ist ein Traum innerhalb des Sinnenwachseins.« Schopenhauer nennt den Traum einen kurzen Wahnsinn und den Wahnsinn einen langen Traum. Hagen bezeichnet das Delirium als Traumleben, welches nicht durch Schlaf, sondern durch Krankheiten herbeigeführt ist. Wundt äußert in der »Physiologischen Psychologie«: »In der Tat können wir im Traume fast alle Erscheinungen, die uns in den Irrenhäusern begegnen, selber durchleben.«
Die einzelnen Übereinstimmungen, auf Grund deren eine solche Gleichstellung sich dem Urteil empfiehlt, zählt Spitta (übrigens sehr ähnlich wie Maury) in folgender Reihe auf: »1. Aufhebung oder doch Retardation des Selbstbewußtseins, infolgedessen Unkenntnis über den Zustand als solchen, also Unmöglichkeit des Erstaunens, Mangel des moralischen Bewußtseins. 2. Modifizierte Perzeption der Sinnesorgane, und zwar im Traume verminderte, im Wahnsinn im allgemeinen sehr gesteigerte. 3. Verbindung der Vorstellungen untereinander lediglich nach den Gesetzen der Assoziation und Reproduktion, also automatische Reihenbildung, daher Unproportionalität der Verhältnisse zwischen den Vorstellungen (Übertreibungen, Phantasmen) und aus alle dem resultierend 4. Veränderung beziehungsweise Umkehrung der Persönlichkeit und zuweilen der Eigentümlichkeiten des Charakters (Perversitäten).«
Radestock fügt noch einige Züge hinzu, Analogien im Material: »Im Gebiete des Gesichts– und Gehörsinnes und des Gemeingefühles findet man die meisten Halluzinationen und Illusionen. Die wenigsten Elemente liefern wie beim Traume der Geruchs– und Geschmacksinn. – Dem Fieberkranken steigen in den Delirien wie dem Träumenden Erinnerungen aus langer Vergangenheit auf; was der Wachende und Gesunde vergessen zu haben schien, dessen erinnert sich der Schlafende und Kranke.« – Die Analogie von Traum und Psychose erhält erst dadurch ihren vollen Wert, daß sie sich wie eine Familienähnlichkeit in die feinere Mimik und bis auf einzelne Auffälligkeiten des Gesichtsausdruckes erstreckt.
»Dem von körperlichen und geistigen Leiden Gequälten gewährt der Traum, was die Wirklichkeit versagte: Wohlsein und Glück; so heben sich auch bei dem Geisteskranken die lichten Bilder von Glück, Größe, Erhabenheit und Reichtum. Der vermeintliche Besitz von Gütern und die imaginäre Erfüllung von Wünschen, deren Verweigerung oder Vernichtung eben einen psychischen Grund des Irreseins abgaben, machen häufig den Hauptinhalt des Deliriums aus. Die Frau, die ein teures Kind verloren, deliriert in Mutterfreuden, wer Vermögensverluste erlitten, hält sich für außerordentlich reich, das betrogene Mädchen sieht sich zärtlich geliebt.«
(Diese Stelle Radestocks ist die Abkürzung einer feinsinnigen Ausführung von Griesinger [p. 111], die mit aller Klarheit die Wunscherfüllung als einen dem Traume und der Psychose gemeinsamen Charakter des Vorstellens enthüllt. Meine eigenen Untersuchungen haben mich gelehrt, daß hier der Schlüssel zu einer psychologischen Theorie des Traumes und der Psychosen zu finden ist.)
»Barocke Gedankenverbindungen und Schwäche des Urteiles sind es, welche den Traum und den Wahnsinn hauptsächlich charakterisieren.« Die Überschätzung der eigenen geistigen Leistungen, die dem nüchternen Urteil als unsinnig erscheinen, findet sich hier wie dort; dem rapiden Vorstellungsverlauf des Traumes entspricht die Ideenflucht der Psychose. Bei beiden fehlt jedes Zeitmaß. Die Spaltung der Persönlichkeit im Traume, welche z. B. das eigene Wissen auf zwei Personen verteilt, von denen die fremde das eigene Ich im Traume korrigiert, ist völlig gleichwertig der bekannten Persönlichkeitsteilung bei halluzinatorischer Paranoia; auch der Träumer hört die eigenen Gedanken von fremden Stimmen vorgebracht. Selbst für die konstanten Wahnideen findet sich eine Analogie in den stereotyp wiederkehrenden pathologischen Träumen (rêve obsédant). – Nach der Genesung von einem Delirium sagen die Kranken nicht selten, daß ihnen die ganze Zeit ihrer Krankheit wie ein oft nicht unbehaglicher Traum erscheint, ja sie teilen uns mit, daß sie gelegentlich noch während der Krankheit geahnt haben, sie seien nur in einem Traume befangen, ganz wie es oft im Schlaftraume vorkommt. Nach alledem ist es nicht zu verwundern, wenn Radestock seine wie vieler anderer Meinung in den Worten zusammenfaßt, daß »der Wahnsinn, eine anormale krankhafte Erscheinung, als eine Steigerung des periodisch wiederkehrenden normalen Traumzustandes zu betrachten ist« (p. 228).
Noch inniger vielleicht, als es durch diese Analogie der sich äußernden Phänomene möglich ist, hat Krauss die Verwandtschaft von Traum und Wahnsinn in der Ätiologie (vielmehr: in den Erregungsquellen) begründen wollen. Das beiden gemeinschaftliche Grundelement ist nach ihm, wie wir gehört haben, die organisch bedingte Empfindung, die Leibreizsensation, das durch Beiträge von allen Organen her zustande gekommene Gemeingefühl (vgl. Peisse bei Maury [p. 52]).
Die nicht zu bestreitende, bis in charakteristische Einzelheiten reichende Übereinstimmung von Traum und Geistesstörung gehört zu den stärksten Stützen der medizinischen Theorie des Traumlebens, nach welcher sich der Traum als ein unnützer und störender Vorgang und als Ausdruck einer herabgesetzten Seelentätigkeit darstellt. Man wird indes nicht erwarten können, die endgültige Aufklärung über den Traum von den Seelenstörungen her zu empfangen, wo es allgemein bekannt ist, in welch unbefriedigendem Zustand unsere Einsicht in den Hergang der letzteren sich befindet. Wohl aber ist es wahrscheinlich, daß eine veränderte Auffassung des Traumes unsere Meinungen über den inneren Mechanismus der Geistesstörungen mitbeeinflussen muß, und so dürfen wir sagen, daß wir auch an der Aufklärung der Psychosen arbeiten, wenn wir uns bemühen, das Geheimnis des Traumes aufzuhellen.
Es bedarf einer Rechtfertigung, daß ich die Literatur der Traumprobleme nicht auch über den Zeitabschnitt vom ersten Erscheinen bis zur zweiten Auflage dieses Buches fortgeführt habe. Dieselbe mag dem Leser wenig befriedigend erscheinen; ich bin nichtsdestoweniger durch sie bestimmt worden. Die Motive, die mich überhaupt zu einer Darstellung der Behandlung des Traumes in der Literatur veranlaßt hatten, waren mit der vorstehenden Einleitung erschöpft, eine Fortsetzung dieser Arbeit hätte mich außerordentliche Bemühung gekostet und – sehr wenig Nutzen oder Belehrung gebracht. Denn der in Rede stehende Zeitraum von neun Jahren hat weder an tatsächlichem Material noch an Gesichtspunkten für die Auffassung des Traumes Neues oder Wertvolles gebracht. Meine Arbeit ist in den meisten seither veröffentlichten Publikationen unerwähnt und unberücksichtigt geblieben; am wenigsten Beachtung hat sie natürlich bei den sogenannten »Traumforschern« gefunden, die von der dem wissenschaftlichen Menschen eigenen Abneigung, etwas Neues zu erlernen, hiemit ein glänzendes Beispiel gegeben haben. »Les savants ne sont pas curieux,« meint der Spötter Anatole France. Wenn es in der Wissenschaft ein Recht zur Revanche gibt, so wäre ich wohl berechtigt, auch meinerseits die Literatur seit dem Erscheinen dieses Buches zu vernachlässigen. Die wenigen Berichterstattungen, die sich in wissenschaftlichen Journalen gezeigt haben, sind so voll von Unverstand und Mißverständnissen, daß ich den Kritikern mit nichts anderem als mit der Aufforderung, dieses Buch noch einmal zu lesen, antworten könnte. Vielleicht dürfte die Aufforderung auch lauten: es überhaupt zu lesen.
In den Arbeiten jener Ärzte, welche sich zur Anwendung des psychoanalytischen Heilverfahrens entschlossen haben und anderer sind reichlich Träume veröffentlicht und nach meinen Anweisungen gedeutet worden. Soweit diese Arbeiten über die Bestätigung meiner Aufstellungen hinausgehen, habe ich deren Ergebnisse in den Zusammenhang meiner Darstellung eingetragen. Ein zweites Literaturverzeichnis am Ende stellt die wichtigsten Veröffentlichungen seit dem ersten Erscheinen dieses Buches zusammen. Das reichhaltige Buch von Sante de Sanctis über die Träume, dem bald nach seinem Erscheinen eine Übersetzung ins Deutsche zu teil geworden ist, hat sich mit meiner »Traumdeutung« zeitlich gekreuzt, so daß ich von ihm ebensowenig Notiz nehmen konnte wie der italienische Autor von mir. Ich mußte dann leider urteilen, daß seine fleißige Arbeit überaus arm an Ideen sei, so arm, daß man aus ihr nicht einmal die Möglichkeit der bei mir behandelten Probleme ahnen könnte.
Ich habe nur zweier Erscheinungen zu gedenken, die nahe an meine Behandlung der Traumprobleme streifen. Ein jüngerer Philosoph, H. Swoboda, der es unternommen hat, die Entdeckung der biologischen Periodizität (in Reihen von 23 und 28 Tagen), die von Wilh. Fliess herrührt, auf das psychische Geschehen auszudehnen, hat in einer phantasievollen Schrift[25 - H. Swoboda, Die Perioden des menschlichen Organismus, 1904.] mit diesem Schlüssel unter anderm auch das Rätsel der Träume lösen wollen. Die Bedeutung der Träume wäre dabei zu kurz gekommen; das Inhaltsmaterial derselben würde sich durch das Zusammentreffen all jener Erinnerungen erklären, die in jener Nacht gerade eine der biologischen Perioden zum ersten– oder n–tenmal vollenden. Eine persönliche Mitteilung des Autors ließ mich zuerst annehmen, daß er selbst diese Lehre nicht mehr ernsthaft vertreten wolle. Es scheint, daß ich mich in diesem Schluß geirrt habe; ich werde an anderer Stelle einige Beobachtungen zu der Aufstellung Swobodas mitteilen, die mir aber ein überzeugendes Ergebnis nicht gebracht haben. Bei weitem erfreulicher war mir der Zufall, an unerwarteter Stelle eine Auffassung des Traumes zu finden, die sich mit dem Kern der meinigen völlig deckt. Die Zeitverhältnisse schließen die Möglichkeit aus, daß jene Äußerung durch die Lektüre meines Buches beeinflußt worden sei; ich muß also in ihr die einzige in der Literatur nachweisbare Übereinstimmung eines unabhängigen Denkers mit dem Wesen meiner Traumlehre begrüßen. Das Buch, in dem sich die von mir ins Auge gefaßte Stelle über das Träumen findet, ist 1900 in zweiter Auflage unter dem Titel »Phantasien eines Realisten« von Lynkeus veröffentlicht worden[26 - Siehe später p. 229, Anmerkung.].
Zusatz (1914).
Die vorstehende Rechtfertigung ist im Jahre 1909 niedergeschrieben worden. Seither hat sich die Sachlage allerdings geändert; mein Beitrag zur »Traumdeutung« wird in der Literatur nicht mehr übersehen. Allein die neue Situation macht mir die Fortsetzung des vorstehenden Berichtes erst recht unmöglich. Die »Traumdeutung« hat eine ganze Reihe neuer Behauptungen und Probleme gebracht, die nun von den Autoren in verschiedenster Weise erörtert worden sind. Ich kann diese Arbeiten doch nicht darstellen, ehe ich meine eigenen Ansichten entwickelt habe, auf welche die Autoren sich beziehen. Was mir an dieser neuesten Literatur wertvoll erschien, habe ich darum im Zusammenhange meiner nun folgenden Ausführungen gewürdigt.
II. Die Methode der Traumdeutung. Die Analyse eines Traummusters
Die Überschrift, die ich meiner Abhandlung gegeben habe, läßt erkennen, an welche Tradition in der Auffassung der Träume ich anknüpfen möchte. Ich habe mir vorgesetzt, zu zeigen, daß Träume einer Deutung fähig sind, und Beiträge zur Klärung der eben behandelten Traumprobleme werden sich mir nur als etwaiger Nebengewinn bei der Erledigung meiner eigentlichen Aufgabe ergeben können. Mit der Voraussetzung, daß Träume deutbar sind, trete ich sofort in Widerspruch zu der herrschenden Traumlehre, ja zu allen Traumtheorien mit Ausnahme der Schernerschen, denn »einen Traum deuten« heißt, seinen »Sinn« angeben, ihn durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertiges Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt. Wie wir erfahren haben, lassen aber die wissenschaftlichen Theorien des Traumes für ein Problem der Traumdeutung keinen Raum, denn der Traum ist für sie überhaupt kein seelischer Akt, sondern ein somatischer Vorgang, der sich durch Zeichen am seelischen Apparat kundgibt. Anders hat sich zu allen Zeiten die Laienmeinung benommen. Sie bedient sich ihres guten Rechtes, inkonsequent zu verfahren, und obwohl sie zugesteht, der Traum sei unverständlich und absurd, kann sie sich doch nicht entschließen, dem Traume jede Bedeutung abzusprechen. Von einer dunklen Ahnung geleitet, scheint sie doch anzunehmen, der Traum habe einen Sinn, wiewohl einen verborgenen, er sei zum Ersatze eines anderen Denkvorganges bestimmt, und es handle sich nur darum, diesen Ersatz in richtiger Weise aufzudecken, um zur verborgenen Bedeutung des Traumes zu gelangen.
Die Laienwelt hat sich darum von jeher bemüht, den Traum zu »deuten« und dabei zwei im Wesen verschiedene Methoden versucht. Das erste dieser Verfahren faßt den Trauminhalt als Ganzes ins Auge und sucht denselben durch einen anderen, verständlichen und in gewissen Hinsichten analogen Inhalt zu ersetzen. Dies ist die symbolische Traumdeutung; sie scheitert natürlich von vornherein an jenen Träumen, welche nicht bloß unverständlich, sondern auch verworren erscheinen. Ein Beispiel für ihr Verfahren gibt etwa die Auslegung, welche der biblische Josef dem Traume des Pharao angedeihen ließ. Sieben fette Kühe, nach denen sieben magere kommen, welche die ersteren aufzehren, das ist ein symbolischer Ersatz für die Vorhersagung von sieben Hungerjahren im Lande Ägypten, welche allen Überfluß aufzehren, den sieben fruchtbare Jahre geschaffen haben. Die meisten der artefiziellen Träume, welche von Dichtern geschaffen wurden, sind für solche symbolische Deutung bestimmt, denn sie geben den vom Dichter gefaßten Gedanken in einer Verkleidung wieder, die zu den aus der Erfahrung bekannten Charakteren unseres Träumens passend gefunden wird[27 - In einer Novelle »Gradiva« des Dichters W. Jensen entdeckte ich zufällig mehrere artifizielle Träume, die vollkommen korrekt gebildet waren und sich deuten ließen, als wären sie nicht erfunden, sondern von realen Personen geträumt worden. Der Dichter bestätigte auf Anfrage von meiner Seite, daß ihm meine Traumlehre fremd geblieben war. Ich habe diese Übereinstimmung zwischen meiner Forschung und dem Schaffen des Dichters als Beweis für die Richtigkeit meiner Traumanalyse verwertet. (»Der Wahn und die Träume« in W. Jensens »Gradiva«, erstes Heft der von mir herausgegebenen »Schriften zur angewandten Seelenkunde«, 1906.)]. Die Meinung, der Traum beschäftige sich vorwiegend mit der Zukunft, deren Gestaltung er im voraus ahne – ein Rest der einst den Träumen zuerkannten prophetischen Bedeutung —, wird dann zum Motiv, den durch symbolische Deutung gefundenen Sinn des Traumes durch ein »es wird« ins Futurum zu versetzen.
Wie man den Weg zu einer solchen symbolischen Deutung findet, dazu läßt sich eine Unterweisung natürlich nicht geben. Das Gelingen bleibt Sache des witzigen Einfalles, der unvermittelten Intuition, und darum konnte die Traumdeutung mittels Symbolik sich zu einer Kunstübung erheben, die an eine besondere Begabung gebunden schien[28 - Aristoteles hat sich dahin geäußert, der beste Traumdeuter sei der, welcher Ähnlichkeiten am besten auffasse; denn die Traumbilder seien, wie die Bilder im Wasser, durch die Bewegung verzerrt, und der treffe am besten, der in dem verzerrten Bild das Wahre zu erkennen vermöge (Büchsenschütz, p. 65).]. Von solchem Anspruch hält sich die andere der populären Methoden der Traumdeutung völlig fern. Man könnte sie als die »Chiffriermethode« bezeichnen, da sie den Traum wie eine Art von Geheimschrift behandelt, in der jedes Zeichen nach einem feststehenden Schlüssel in ein anderes Zeichen von bekannter Bedeutung übersetzt wird. Ich habe z. B. von einem Briefe geträumt, aber auch von einem Leichenbegängnis u. dgl.; ich sehe nun in einem »Traumbuche« nach und finde, daß »Brief« mit »Verdruß«, »Leichenbegängnis« mit »Verlobung« zu übersetzen ist. Es bleibt mir dann überlassen, aus den Schlagworten, die ich entziffert habe, einen Zusammenhang herzustellen, den ich wiederum als zukünftig hinnehme. Eine interessante Abänderung dieses Chiffrierverfahrens, durch welche dessen Charakter als rein mechanische Übertragung einigermaßen korrigiert wird, zeigt sich in der Schrift über Traumdeutung des Artemidoros aus Daldis[29 - Artemidoros aus Daldis, wahrscheinlich, zu Anfang des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung geboren, hat uns die vollständigste und sorgfältigste Bearbeitung der Traumdeutung in der griechisch–römischen Welt überliefert. Er legte, wie Th. Gomperz hervorhebt, Wert darauf, die Deutung der Träume auf Beobachtung und Erfahrung zu gründen und sonderte seine Kunst strenge von anderen, trügerischen Künsten. Das Prinzip seiner Deutungskunst ist nach der Darstellung von Gomperz identisch mit dem der Magie, das Prinzip der Assoziation. Ein Traumding bedeutet das, woran es erinnert. Wohlverstanden, woran es den Traumdeuter erinnert! Eine nicht zu beherrschende Quelle der Willkür und Unsicherheit ergibt sich dann aus dem Umstand, daß das Traumelement den Deuter an verschiedene Dinge und jeden an etwas anderes erinnern kann. Die Technik, die ich im folgenden auseinandersetze, weicht von der antiken in dem einen wesentlichen Punkte ab, daß sie dem Träumer selbst die Deutungsarbeit auferlegt. Sie will nicht berücksichtigen, was dem Traumdeuter, sondern was dem Träumer zu dem betreffenden Element des Traumes einfällt. – Nach neueren Berichten des Missionärs Tfinkdji (Anthropos 1913) nehmen aber auch die modernen Traumdeuter des Orients die Mitwirkung des Träumers ausgiebig in Anspruch. Der Gewährsmann erzählt von den Traumdeutern bei den mesopotamischen Arabern: »Pour interpréter exactement un songe, les oniromanciens les plus habiles s'informent de ceux qui les consultent de toutes les circonstances qu'il regardent nécessaires pour la bonne explication . . . . . . En un mot, nos oniromanciens ne laissent aucune circonstance leur échapper et ne donnent l'interprétation désirée avant d'avoir parfaitement saisi et reçu toutes les interrogations desirables.« Unter diesen Fragen befinden sich regelmäßig solche um genaue Angaben über die nächsten Familienangehörigen (Eltern, Frau, Kinder) sowie die typische Formel: habuistine in hac nocte copulam conjugalem ante vel post somnium? – »L'idée dominante dans l'interprétation des songes consiste à expliquer le rêve par son opposé.«]. Hier wird nicht nur auf den Trauminhalt, sondern auch auf die Person und die Lebensumstände des Träumers Rücksicht genommen, so daß das nämliche Traumelement für den Reichen, den Verheirateten, den Redner andere Bedeutung hat als für den Armen, den Ledigen und etwa den Kaufmann. Das Wesentliche an diesem Verfahren ist nun, daß die Deutungsarbeit nicht auf das Ganze des Traumes gerichtet wird, sondern auf jedes Stück des Trauminhaltes für sich, als ob der Traum ein Konglomerat wäre, in dem jeder Brocken Gestein eine besondere Bestimmung verlangt. Es sind sicherlich die unzusammenhängenden und verworrenen Träume, von denen der Antrieb zur Schöpfung der Chiffriermethode ausgegangen ist[30 - Dr. Alf. Robitsek macht mich darauf aufmerksam, daß die orientalischen Traumbücher, von denen die unserigen klägliche Abklatsche sind, die Deutung der Traumelemente meist nach dem Gleichklang und der Ähnlichkeit der Worte vornehmen. Da diese Verwandtschaften bei der Übersetzung in unsere Sprache verloren gehen müssen, würde daher die Unbegreiflichkeit der Ersetzungen in unseren populären »Traumbüchern« stammen. – Über diese außerordentliche Bedeutung des Wortspieles und der Wortspielerei in den alten orientalischen Kulturen mag man sich aus den Schriften Hugo Wincklers unterrichten. Das schönste Beispiel einer Traumdeutung, welches uns aus dem Altertum überliefert ist, beruht auf einer Wortspielerei. Artemidoros erzählt (p. 255): »Es scheint mir aber auch Aristandros dem Alexandros von Makedonien eine gar glückliche Auslegung gegeben zu haben, als dieser Tyros eingeschlossen hielt und belagerte und wegen des großen Zeitverlustes, unwillig und betrübt, das Gefühl hatte, er sehe einen Satyros auf seinem Schilde tanzen; zufällig befand sich Aristandros in der Nähe von Tyros und im Geleite des Königs, der die Syrier bekriegte. Indem er nun das Wort Satyros in σὰ und Τύρος zerlegte, bewirkte er, daß der König die Belagerung nachdrücklicher in Angriff nahm, so daß er Herr der Stadt wurdet.« (Σὰ–Τύρος = dein ist Tyros.) – Übrigens hängt der Traum so innig am sprachlichen Ausdruck, daß Ferenczi mit Recht bemerken kann, jede Sprache habe ihre eigene Traumsprache. Ein Traum ist in der Regel unübersetzbar in andere Sprachen und ein Buch wie das vorliegende, meinte ich, darum auch. Nichtsdestoweniger ist es Dr. A. A. Brill in New York gelungen, eine englische Übersetzung der »Traumdeutung« zu schaffen. (London 1913, George Allen & Co. Ltd.)].
Für die wissenschaftliche Behandlung des Themas kann die Unbrauchbarkeit beider populärer Deutungsverfahren des Traumes keinen Moment lang zweifelhaft sein. Die symbolische Methode ist in ihrer Anwendung beschränkt und keiner allgemeinen Darlegung fähig. Bei der Chiffriermethode käme alles darauf an, daß der »Schlüssel«, das Traumbuch, verläßlich wäre, und dafür fehlen alle Garantien. Man wäre versucht, den Philosophen und Psychiatern Recht zu geben und mit ihnen das Problem der Traumdeutung als eine imaginäre Aufgabe zu streichen[31 - Nach Abschluß meines Manuskriptes ist mir eine Schrift von Stumpf zugegangen, die in der Absicht zu erweisen, der Traum sei sinnvoll und deutbar, mit meiner Arbeit zusammentrifft. Die Deutung geschieht aber mittels einer allegorisierenden Symbolik ohne Gewähr für Allgemeingültigkeit des Verfahrens.].
Allein ich bin eines Besseren belehrt worden. Ich habe einsehen müssen, daß hier wiederum einer jener nicht seltenen Fälle vorliegt, in denen ein uralter, hartnäckig festgehaltener Volksglaube der Wahrheit der Dinge näher gekommen zu sein scheint als das Urteil der heute geltenden Wissenschaft. Ich muß behaupten, daß der Traum wirklich eine Bedeutung hat und daß ein wissenschaftliches Verfahren der Traumdeutung möglich ist. Zur Kenntnis dieses Verfahrens bin ich auf folgende Weise gelangt:
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Auflösung gewisser psychopathologischer Gebilde, der hysterischen Phobien, der Zwangsvorstellungen u. a. in therapeutischer Absicht; seitdem ich nämlich aus einer bedeutsamen Mitteilung von Josef Breuer weiß, daß für diese als Krankheitssymptome empfundenen Bildungen Auflösung und Lösung in eines zusammenfallen[32 - Breuer und Freud, Studien über Hysterie, Wien 1895, 2. Aufl., 1909.]. Hat man eine solche pathologische Vorstellung auf die Elemente zurückführen können, aus denen sie im Seelenleben des Kranken hervorgegangen ist, so ist diese auch zerfallen, der Kranke von ihr befreit. Bei der Ohnmacht unserer sonstigen therapeutischen Bestrebungen und angesichts der Rätselhaftigkeit dieser Zustände erschien es mir verlockend, auf dem von Breuer eingeschlagenen Wege trotz aller Schwierigkeiten bis zur vollen Aufklärung vorzudringen. Wie sich die Technik des Verfahrens schließlich gestaltet hat und welches die Ergebnisse der Bemühung gewesen sind, darüber werde ich an anderen Orten ausführlich Bericht zu erstatten haben. Im Verlaufe dieser psychoanalytischen Studien geriet ich auf die Traumdeutung. Die Patienten, die ich verpflichtet hatte, mir alle Einfälle und Gedanken mitzuteilen, die sich ihnen zu einem bestimmten Thema aufdrängten, erzählten mir ihre Träume und lehrten mich so, daß ein Traum in die psychische Verkettung eingeschoben sein kann, die von einer pathologischen Idee her nach rückwärts in der Erinnerung zu verfolgen ist. Es lag nun nahe, den Traum selbst wie ein Symptom zu behandeln und die für letztere ausgearbeitete Methode der Deutung auf ihn anzuwenden.